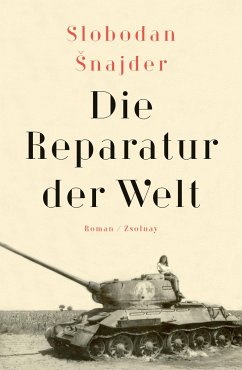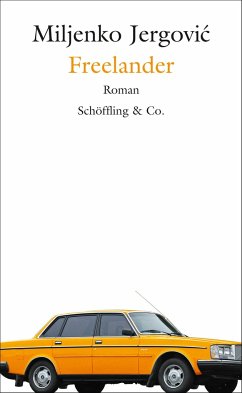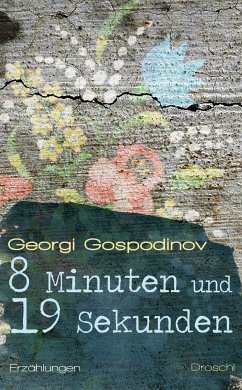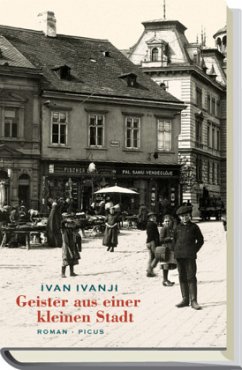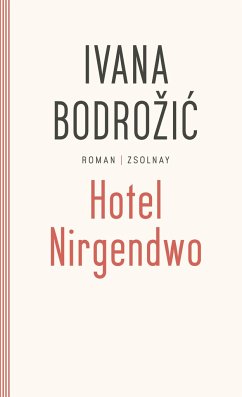Nach dem Sturm
Roman

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Alt ist Ivo noch nicht, höchstens an der Grenze, aber zu alt dann doch, um sich in die Freundin des eigenen Sohnes zu verlieben. Seit die junge Frau im Museum auf der Festung arbeitet, Tür an Tür mit Ivo, der dort sein Restaurant hat, findet er keine Ruhe mehr. Mira raubt ihm den Schlaf. Nicht im Ehebett, das teilt er längst nicht mehr mit seiner Frau, die Gesangslehrerin ist, aber ein Star hätte werden können. Überhaupt ist alles anders gekommen in der kleinen Stadt an der Grenze, wo Westen und Osten, Norden und Süden aneinanderstoßen. Anders als erhofft. Es ist August, es ist drück...
Alt ist Ivo noch nicht, höchstens an der Grenze, aber zu alt dann doch, um sich in die Freundin des eigenen Sohnes zu verlieben. Seit die junge Frau im Museum auf der Festung arbeitet, Tür an Tür mit Ivo, der dort sein Restaurant hat, findet er keine Ruhe mehr. Mira raubt ihm den Schlaf. Nicht im Ehebett, das teilt er längst nicht mehr mit seiner Frau, die Gesangslehrerin ist, aber ein Star hätte werden können. Überhaupt ist alles anders gekommen in der kleinen Stadt an der Grenze, wo Westen und Osten, Norden und Süden aneinanderstoßen. Anders als erhofft. Es ist August, es ist drückend heiß, seine Tochter Ana hat Geburtstag, ein großes Fest steht bevor. Als wäre die Katastrophe, die Ivo auf sich zukommen sieht, nicht schon genug, hat sein Sohn auch noch einen Autounfall.Im Duktus einer Märchenerzählerin verwebt Nellja Veremej die Geschichte ihres Helden mit Mythen, Fabeln und Legenden. Aus dem leisen Humor, mit dem sie ihre Figuren, ihre Hoffnungen und Nöte betrachtet, spricht die Zuneigung einer Autorin, die aus eigener Erfahrung weiß, dass Geschichte aus Geschichten gemacht ist, dass sich das Große im Kleinen spiegelt. Nellja Veremej kann davon erzählen - und wie!
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.



 buecher-magazin.deAuf einem Berg im Südosten Europas ruht eine Zitadelle, prächtig, einst erbaut, um der Bevölkerung Schutz zu gewähren. Selbst wenn ihre Fassaden inzwischen ein wenig bröckeln, blieb das Herz der Festung, der eigentliche Protagonist in "Nach dem Sturm", unzerstörbar. Trotz Zusammenbruchs des Eisernen Vorhangs und trotz anschließender Globalisierung. Vielleicht, weil an diesem (fiktiven) Ort, gelegen zwischen Osten und Westen, zwei Welten aufeinandertreffen und ein energetisches Dazwischen bilden. Wohingegen momentan die Rechtspopulisten nach Abschottung rufen, setzt die 1963 in der Sowjetunion geborene Autorin auf eine Stätte des Dialogs - sogar über Zeitgrenzen hinweg: Die Geschichte der Festungsbewohner reicht von einem Waisenjungen aus dem Mittelalter bis hin zu Ivo, dem Verkrachten einer Touristengaststätte. Indem Veremej verschiedene Handlungsstränge verschachtelt, knüpft sie spielerisch an orientalische Erzähltraditionen an. Nichtsdestotrotz bringt die Gebärde, derartig aus dem Vollen zu schöpfen, auch Schwierigkeiten mit sich: Eine bildhaft überfrachtete Sprache und manche Plauderei blähen das Prosageflecht auf. Lesenswert ist dieses bunte Panoptikum jedoch allemal - gerade in einer Gesellschaft, die allzu erhitzt über europäische Identität und Werte streitet.
buecher-magazin.deAuf einem Berg im Südosten Europas ruht eine Zitadelle, prächtig, einst erbaut, um der Bevölkerung Schutz zu gewähren. Selbst wenn ihre Fassaden inzwischen ein wenig bröckeln, blieb das Herz der Festung, der eigentliche Protagonist in "Nach dem Sturm", unzerstörbar. Trotz Zusammenbruchs des Eisernen Vorhangs und trotz anschließender Globalisierung. Vielleicht, weil an diesem (fiktiven) Ort, gelegen zwischen Osten und Westen, zwei Welten aufeinandertreffen und ein energetisches Dazwischen bilden. Wohingegen momentan die Rechtspopulisten nach Abschottung rufen, setzt die 1963 in der Sowjetunion geborene Autorin auf eine Stätte des Dialogs - sogar über Zeitgrenzen hinweg: Die Geschichte der Festungsbewohner reicht von einem Waisenjungen aus dem Mittelalter bis hin zu Ivo, dem Verkrachten einer Touristengaststätte. Indem Veremej verschiedene Handlungsstränge verschachtelt, knüpft sie spielerisch an orientalische Erzähltraditionen an. Nichtsdestotrotz bringt die Gebärde, derartig aus dem Vollen zu schöpfen, auch Schwierigkeiten mit sich: Eine bildhaft überfrachtete Sprache und manche Plauderei blähen das Prosageflecht auf. Lesenswert ist dieses bunte Panoptikum jedoch allemal - gerade in einer Gesellschaft, die allzu erhitzt über europäische Identität und Werte streitet.