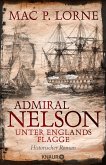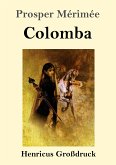Antonia, eine junge Fotografin, trifft auf Korsika eines Abends unerwartet auf den Soldner Dragan, den sie Jahre zuvor im Jugoslawienkrieg kennengelernt hat. Nach Stunden intensiver Unterhaltung entscheidet sich die junge Frau heim in die Berge zu fahren und verunglückt todlich.Die Totenmesse wird von ihrem Onkel, einem Priester abgehalten. Um seine unendliche Trauer über den Tod der innig geliebten Nichte im Zaum zu halten, entscheidet er sich für die strikte Einhaltung der Regeln der Liturgie. Im Glutofen der kleinen Kirche aber steigen Bilder der Erinnerung aus dem Leben der Verstorbenen auf ...Sie führen vom militanten Nationalismus auf Korsika über die verheerenden Kriege des 20. Jahrhunderts ins Herz der Frage nach der menschlichen Existenz, dem Glauben, der Macht von Politik und bringen unsere Vorstellung von Zeit, Wirklichkeit und Tod ins Wanken.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Bilder von einem bösen Ende: In seinem Requiem einer jungen Fotografin meditiert Jérôme Ferrari über die Vergänglichkeit.
Schreiben Philosophen gute Romane? Ein zündender Einfall führt nicht zwangsläufig zu einer lesenswerten Geschichte, und systematische Untersuchungen eines Weltausschnitts werden erst dann zu Literatur, wenn sie mit greifbaren Figuren belebt werden. Dem französischen Philosophielehrer und Schriftsteller Jérôme Ferrari hat man gelegentlich vorgeworfen, seine Romane seien thematisch-didaktisch überfrachtet. In seiner "Predigt auf den Untergang Roms", für die er 2012 den Prix Goncourt erhielt, wechselten Betrachtungen über den Zerfall von Großreichen dabei mit lebensprallen Szenen des Untergangs einer Bar in einem korsischen Kaff, inklusive Saufgelagen, Eifersuchtsdramen und deftigen libidinösen Ausschweifungen. In "Ein Gott ein Tier" exemplifizierte Ferrari dann die Leiden der modernen Welt in einer Niedergangs-Prosa, indem er zwei müde Krieger aufeinanderprallen ließ - der eine ein traumatisierter Söldner, die andere eine erschöpfte Soldatin des Kapitalismus.
Ferraris Interesse für Vergänglichkeit und Untergang liegt auch seinem neuen Roman "Nach seinem Bilde" zugrunde. Die Hauptfigur Antonia, eine Fotografin auf Korsika, geht schon auf den ersten Seiten des Romans mit gerade einmal dreißig Jahren den Weg alles Irdischen, hält Ferraris Geschichte aber dennoch bis zu ihrem bösen Ende zusammen. Antonias Totenmesse, die der Priester - er ist zugleich der Onkel der Verstorbenen - in der Gluthitze einer korsischen Kapelle abhält, ist Ausgangspunkt einer liturgisch rhythmisierten Umkreisung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Tod und Fotografie: das Foto als flüchtiger Ausschnitt einer Wirklichkeit, die in dem Moment dem Tod geweiht ist, in dem der Auslöser gedrückt wird.
"Im Grunde genommen gab es nur zwei Kategorien professioneller Fotografien, solche, die nicht hätten existieren dürfen, und solche, die nichts anderes verdienten, als im Orkus zu verschwinden." Ferraris allwissender Erzähler bringt treffsicher Antonias Konflikt als Fotografin auf den Punkt. Sowohl die stilisierten Fotos von Jungvermählten, die Antonia mit "diabolischer Freude unter brennender Sonne hinreichend lang in ausgeklügelten Verrenkungen posieren lässt", als auch die Schreckensbilder, die sie als Reporterin im Jugoslawien-Krieg zu Gesicht bekommt, bringen sie zur nüchternen Erkenntnis, dass Fotografien der "Suche nach Tiefe die Undurchdringlichkeit ihrer Oberfläche entgegensetzten". Mit anderen Worten: Es braucht einen Erzähler, der das Foto in seinen Kontext bettet.
Wie die Fotografie sind auch das Scheitern in den kleinen Geschichten der Menschen sowie die Brüche in der großen Geschichte Leitmotive in Ferraris Werk, denen er sich in seinem aktuellen Roman abermals widmet. Wo Antonia erkennt, dass sie selbst an der Kriegsfront mit ihrer Kamera nicht der "Wirklichkeit des Lebens den Schleier" wird heben können, müht sich ihr Onkel, der Priester, an Bibelexegese, Theodizee und Liturgie ab. Wieso trauern wir um Verstorbene, wenngleich ihnen das ewige Leben bevorsteht? Welchen Trost kann die Kirche spenden, wenn die Liturgie in Phrasen erstarrt ist? Und was bedeutet es, wenn der Mensch als Gottes Ebenbild geschaffen wurde? "Hätte es eine Fotografie Christi geben können, sie hätte nichts anderes gezeigt als einen zu Tode gefolterten und dem ewigen Tod ausgelieferten Körper", sinniert der Kirchenmann beim Requiem in der überfüllten Kapelle und fühlt sich einmal mehr schuldig. Schließlich war er es, der Antonia die erste Kamera schenkte, durch deren Linse sie das Unheil auf der Erde sehen und sich daraufhin vom Glauben abwenden würde.
Um dem Geheimnis der Fotografie auf die Spur zu kommen, begibt sich Ferrari auf eine literarische Zeitreise mit essayistischen Zwischenstopps. Er taucht ab in die Anfänge der professionellen Kriegsreportage im osmanisch-italienischen Krieg von 1911 mit ihrer verstörenden Faszination für Massaker und Hinrichtungen und untersucht daraufhin die Schlachten auf dem Balkan und im Irak 1991. Dann wieder führt der Erzählstrang zurück zu Antonias Anfängen als Lokalreporterin auf Korsika. Ihr Liebesverhältnis zu einem berüchtigten korsischen Separatisten beschert ihr nicht nur exklusive Bilder aus dem Kreis der Terroristen, sondern auch die Erkenntnis, dass der Befreiungskampf des FLNC nur eine "beschissene Mythologie" eitler junger Männer ist, die "das ganze Land inzwischen als Mörder verehrt". Jérôme Ferrari, der selbst einmal dem Front de libération nationale corse nahestand, entscheidet sich im Zweifel immer für den Zweifel an festen Überzeugungen und einfachen Lösungen. In jedem Absatz, so scheint es, schwingt eine wohlmeinende Erinnerung an die menschliche Unvollkommenheit mit, an die Irrwege, die man in Kauf nehmen muss, wenn man den Grund der Dinge ausloten will.
Sein deutscher Verleger und Übersetzer Christian Ruzicska hat Ferraris Ton, der weder das hohe Pathos scheut noch die schmucklose Unmittelbarkeit, stilsicher ins Deutsche übertragen. Das französische "il s'en allait" findet zwar mit "er ging weg" nicht gerade die eleganteste Entsprechung, und auch wird man in Frankreich keine "Bundesstraße" finden und in Serbien kein "Auswärtiges Amt". Diese kleinen Unebenheiten sind aber schnell zu verschmerzen angesichts der Sogwirkung, die Ferraris atmosphärisch dichte Kettensätze auch in der Übersetzung entfalten.
Die Dinge enden schlecht in Ferraris Universum, und das ist auch wörtlich in vielen seiner Romane genau so nachzulesen. "Nach seinem Bilde" liefert dazu literarische Fiktionen, die er mit konkreten Reflexionen systematisch untermauert. Es ist ein philosophischer Roman im besten Sinne, dessen Figuren man in all ihrer menschlichen Unvollkommenheit nicht so schnell vergisst - und das ist ein untrüglicher Beweis für eine gut erzählte Geschichte.
CORNELIUS WÜLLENKEMPER
Jérôme Ferrari: "Nach
seinem Bilde". Roman.
Aus dem Französischen
von Christian Ruzicska.
Secession Verlag für
Literatur, Zürich 2019.
207 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main