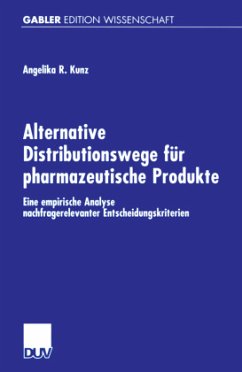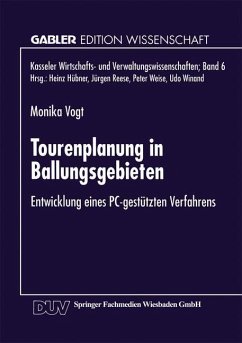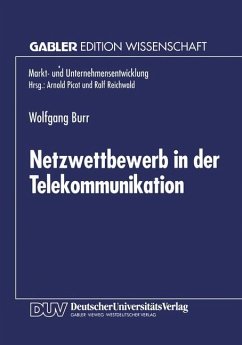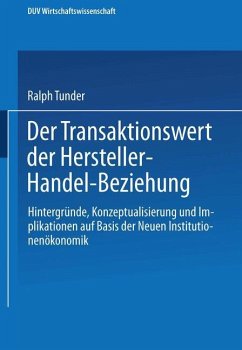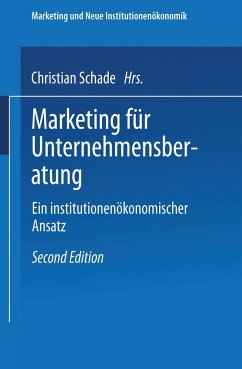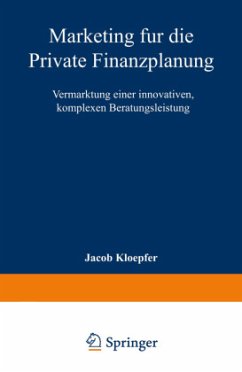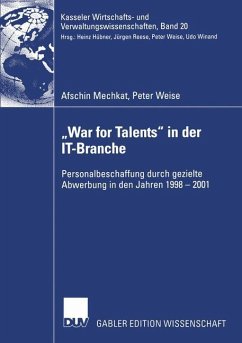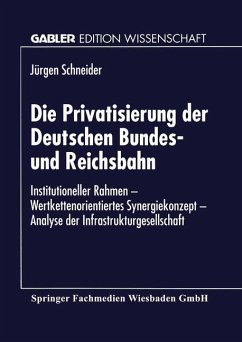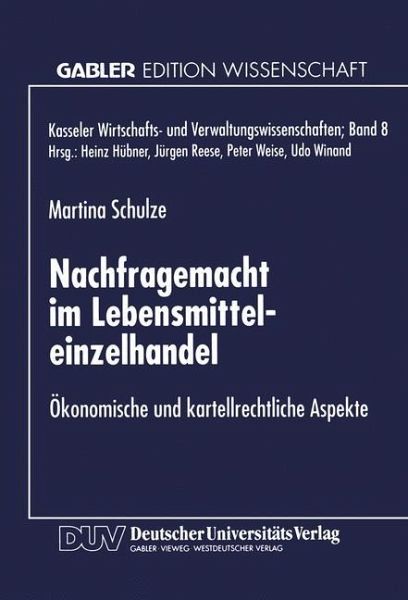
Nachfragemacht im Lebensmitteleinzelhandel
Ökonomische und kartellrechtliche Aspekte

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im Lebensmitteleinzelhandel nimmt die Konzentration weiter zu. Die Händler nutzen den Wettbewerb zwischen den Herstellern um die knappen Regalplätze aus, indem sie immer höhere Preiszugeständnisse fordern und diese auch erhalten. Lebensmittelhersteller, die den Preisforderungen nicht genügen, werden nicht gelistet und vom Markt gedrängt. Martina Schulze untersucht, ob die zu beobachtenden Verhaltensweisen auf eine effiziente Anpassung der Händler-/Herstellerbeziehungen und auf veränderte Marktbedingungen zurückzuführen sind oder lediglich auf der Ausnutzung einer Machtposition beruhe...
Im Lebensmitteleinzelhandel nimmt die Konzentration weiter zu. Die Händler nutzen den Wettbewerb zwischen den Herstellern um die knappen Regalplätze aus, indem sie immer höhere Preiszugeständnisse fordern und diese auch erhalten. Lebensmittelhersteller, die den Preisforderungen nicht genügen, werden nicht gelistet und vom Markt gedrängt. Martina Schulze untersucht, ob die zu beobachtenden Verhaltensweisen auf eine effiziente Anpassung der Händler-/Herstellerbeziehungen und auf veränderte Marktbedingungen zurückzuführen sind oder lediglich auf der Ausnutzung einer Machtposition beruhen. Auf dieser ökonomischen Analyse aufbauend diskutiert die Autorin, inwieweit die zivil- und kartellrechtlichen Rechtsnormen die Besonderheiten der Vertragsbeziehungen und faktischen Abhängigkeiten zwischen Herstellern und Händlern im Lebensmittelhandel erfassen.