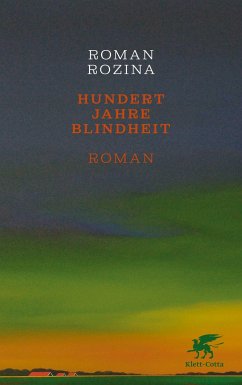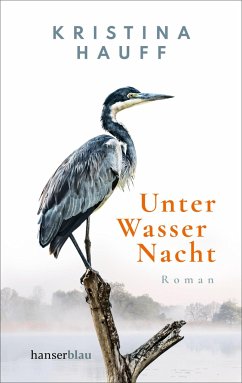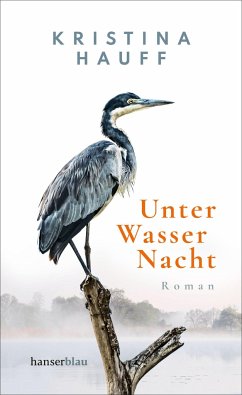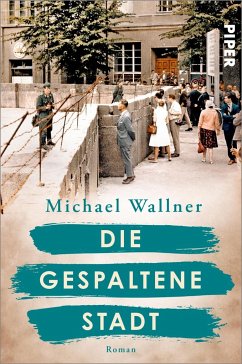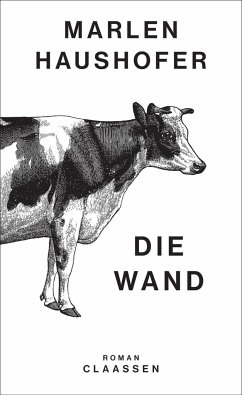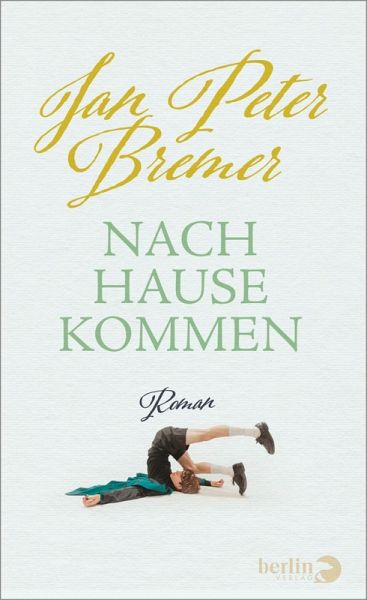
Nachhausekommen
Roman Berührende Jugenderinnerungen aus dem Wendland der 1970er-Jahre

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Sechs Jahre alt ist der Erzähler, als ihn seine Eltern aus dem wilden Berlin der 1970er-Jahre ins dörfliche Gümse des niedersächsischen Wendlands verpflanzen. Nicht nur ist sein imposanter Vater ein erfolgreicher Künstler, auch wird ihr Zuhause ein regelmäßiger Treffpunkt für die Kunst- und Kulturszene der alten Bundesrepublik. Mit dem intellektuellen, politisch links stehenden Milieu der Eltern und dem ländlich-provinziellen Leben des Dorfes im »Zonenrandgebiet« prallen Welten aufeinander, zwischen denen der Junge Orientierung sucht - und schließlich im Schreiben findet.In einer g...
Sechs Jahre alt ist der Erzähler, als ihn seine Eltern aus dem wilden Berlin der 1970er-Jahre ins dörfliche Gümse des niedersächsischen Wendlands verpflanzen. Nicht nur ist sein imposanter Vater ein erfolgreicher Künstler, auch wird ihr Zuhause ein regelmäßiger Treffpunkt für die Kunst- und Kulturszene der alten Bundesrepublik. Mit dem intellektuellen, politisch links stehenden Milieu der Eltern und dem ländlich-provinziellen Leben des Dorfes im »Zonenrandgebiet« prallen Welten aufeinander, zwischen denen der Junge Orientierung sucht - und schließlich im Schreiben findet.
In einer großen Erinnerungsbewegung schildert Jan Peter Bremer eine Kindheit auf dem Land, seine literarisch meisterhaft erzählte, tragikomisch-berührende Geschichte.
»Jan Peter Bremer erzählt, wie ein kindliches Bewusstsein sich bildet, nämlich sein eigenes, und weil er ein so kluger, eleganter Erzähler ist, ist das unendlich traurig und furchtbar lustig zugleich.« Thomas Hettche
»Mein Kosmos von Jan Peter Bremer ist um ein weiteres Buch bereichert worden: Nachhausekommen. Tragikomisch, berührend, grandios.« Angelika Klüssendorf
In einer großen Erinnerungsbewegung schildert Jan Peter Bremer eine Kindheit auf dem Land, seine literarisch meisterhaft erzählte, tragikomisch-berührende Geschichte.
»Jan Peter Bremer erzählt, wie ein kindliches Bewusstsein sich bildet, nämlich sein eigenes, und weil er ein so kluger, eleganter Erzähler ist, ist das unendlich traurig und furchtbar lustig zugleich.« Thomas Hettche
»Mein Kosmos von Jan Peter Bremer ist um ein weiteres Buch bereichert worden: Nachhausekommen. Tragikomisch, berührend, grandios.« Angelika Klüssendorf