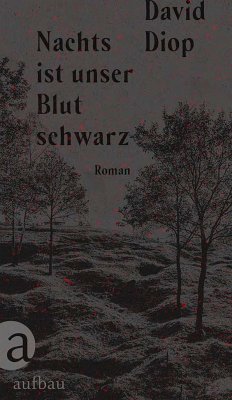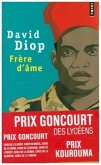Gewinner des "International Booker Prize 2021"
Alfa Ndiaye kämpft im Ersten Weltkrieg an der Seite der Franzosen gegen die Deutschen - ein "Schokosoldat" wie die Kameraden ihn nennen.
Als Alfas geliebter Kindheitsfreund in seinen Armen verblutet, wird er von Wut und Rache gepackt. Wie ein Wahnsinniger zieht er mit seiner Machete über das Schlachtfeld und kehrt jeden Abend mit einem Gewehr des Feindes samt abgetrennter Hand zurück.
Erst bewundern ihn die anderen, dann fürchten sie den Wilden und wenden sich ab. David Diop hinterfragt die Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten und verlagert das Grauen des Krieges ins tiefste Innere. Die Stimme von Alfa Ndiaye betört und verstört. Ein archaischer Roman von unvergleichlicher literarischer Kraft. "Wie ein Tornado nimmt uns dieser kraftvolle, hypnotische Text mit. Atemberaubend!" L'Humanité.
"David Diop ruft uns mit archaischer Wucht die Vergessenen eines grausamen Krieges ins Gedächtnis. Ein großes Buch, das lange nachwirkt." Julia Schoch.
Alfa Ndiaye kämpft im Ersten Weltkrieg an der Seite der Franzosen gegen die Deutschen - ein "Schokosoldat" wie die Kameraden ihn nennen.
Als Alfas geliebter Kindheitsfreund in seinen Armen verblutet, wird er von Wut und Rache gepackt. Wie ein Wahnsinniger zieht er mit seiner Machete über das Schlachtfeld und kehrt jeden Abend mit einem Gewehr des Feindes samt abgetrennter Hand zurück.
Erst bewundern ihn die anderen, dann fürchten sie den Wilden und wenden sich ab. David Diop hinterfragt die Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten und verlagert das Grauen des Krieges ins tiefste Innere. Die Stimme von Alfa Ndiaye betört und verstört. Ein archaischer Roman von unvergleichlicher literarischer Kraft. "Wie ein Tornado nimmt uns dieser kraftvolle, hypnotische Text mit. Atemberaubend!" L'Humanité.
"David Diop ruft uns mit archaischer Wucht die Vergessenen eines grausamen Krieges ins Gedächtnis. Ein großes Buch, das lange nachwirkt." Julia Schoch.

David Diop schickt einen Schwarzafrikaner auf Rachefeldzug in den Ersten Weltkrieg
Während des Ersten Weltkriegs empörte sich Thomas Mann über die Kriegspropaganda der Franzosen und Engländer, die höchst effektiv die Deutschen als Hunnen, Barbaren, Kinderschlächter oder als fettleibige, mit monströsen Darmschläuchen ausgestattete Untermenschen präsentierte. Dagegen versuchte er in seinen polemischen Kriegsartikeln Gegenbilder zu entwickeln, so die folgende Darstellung eines französischen Kriegers: "Ich zeige Ihnen ein Bildchen. Ein Senegalneger, der deutsche Gefangene bewacht, ein Tier mit Lippen so dick wie Kissen, führt seine graue Pfote die Kehle entlang und gurgelt: ,Man sollte sie hinmachen. Es sind Barbaren.'"
Tier, Pfoten, Kissenlippen - ja, wenn das kein Rassismus ist. Thomas Mann veröffentlichte den Essay, in dem diese Sätze zu lesen sind, im April 1915. In jenen Tagen beschäftigte auch Max Weber das Erscheinen des "Senegalnegers" auf den europäischen Kriegsschauplätzen. In einem Brief vom 13. April 1915 reflektierte er über die Spannung von Kultur und Barbarei, in der sich die deutschen Soldaten befänden, nicht aber die "Wilden" aus den Kolonien. Es gebe Menschen, die "inmitten einer raffinierten Kultur leben", aber "trotzdem draußen dem Grausen des Krieges gewachsen sind - was für den Senegalneger keine Leistung ist!"
Nicht die industrielle Kriegsführung rief Entsetzen bei deutschen Intellektuellen hervor, sondern der Einsatz schwarzer Soldaten, rekrutiert aus den Kolonien. Wenn die Stahlgewitter Millionen junge Männer zerfleischen, dann ist dieses mit technologischer Sachlichkeit ausgeführte Inferno auf der Höhe europäischer Zivilisation, die erst durch die Machete gefährdet ist, eine Waffe, mit der die schwarzen Soldaten wegen des Abschreckungseffektes gezielt ausgestattet wurden. In der Machete symbolisiert sich die Mordlust des Wilden. Für die deutsche Kriegspublizistik hatten die Franzosen mit dem Einsatz von Afrikanern das Abendland verraten.
Jetzt hat sich der 1966 in Paris geborene frankosenegalesische Schriftsteller David Diop dieses Themas angenommen, das in der umfangreichen Erzählliteratur über den Ersten Weltkrieg bisher kaum behandelt wurde. Sein Roman "Nachts ist unser Blut schwarz" beschäftigt sich allerdings nicht dokumentarisch mit dem Schicksal der 180 000 "Senegalschützen" in den französischen Verbänden, sondern betreibt literarische Identitätsforschung anhand eines Einzelfalls, der den Lesern mit den Mitteln der Introspektion beklemmend nahegebracht wird.
Bereits im ersten Kapitel liegt der Ich-Erzähler Alfa Ndiaye unter einem Himmel von eiskaltem Blau in einem Erdloch bei seinem schwer verwundeten Kameraden und Kindheitsfreund Mademba Diop, mit dem zusammen er aus einem Dorf in Senegal nach Frankreich gekommen ist. Das Bajonett eines deutschen Soldaten hat Mademba den Bauch aufgerissen. Seine herausgequollenen Gedärme betastend, fleht er den Freund wieder und wieder an, seine Leiden abzukürzen und ihn zu töten. Alfa kann sich zu diesem schrecklichen Freundschaftsdienst jedoch nicht durchringen, und so stirbt Mademba stundenlang vor sich hin.
Bald darauf beginnt Alfa seinen persönlichen Rachefeldzug. Das erlebte Grauen wird ihm zu einer Urszene, die er immer von neuem wiederholt - nun aber mit deutschen Soldaten, die er nach den Angriffen in Erdlöcher verschleppt, wo er ihnen den Bauch öffnet, ihre Organe herausnimmt und ihnen beim langsamen Sterben zusieht. Schließlich hackt er ihnen eine Hand ab, die er als Trophäe mit zurückbringt in den Unterstand. Anfangs sind seine Vorgesetzten noch begeistert von seinem Mut, bis ihnen die Sache mit den Händen unheimlich wird. Er solle es doch bitte nicht übertreiben: "Deine Art der Kriegsführung ist ein bisschen zu wild." Auch seinen Kameraden erscheint der Afrikaner bald von einem bösen Geist besessen. Schließlich wird er zur psychiatrischen Begutachtung ins Hinterland geschickt.
Offenkundig geht es David Diop um die Auseinandersetzung mit der rassistischen Ideologie über die "Schokosoldaten". Weil es den Deutschen graut vor den "Kannibalen" und "Zulus", ist es ihr Auftrag, möglichst martialisch den "Wilden" zu geben. Wenn sie nach dem Pfiff zum Angriff aus dem Schützengraben springen, müssen sie ungeachtet ihrer Todesangst die blutrünstigen Barbaren mit dem Wahnsinn in den Augen spielen. Alfa Ndiaye jedoch kommt ihnen bald wie ein wirklich Wahnsinniger vor, der sich womöglich nur verstellt, solange er sich mit ihnen in den Unterständen aufhält. Als Ich-Erzähler erscheint Alfa aber durchaus nicht verrückt. Er wirkt eher wie eine Art grässlicher Konzeptkünstler, der mit abgehackten Händen und Gedärmen arbeitet, um das rassistische Klischee vom wilden Schwarzen überzuerfüllen. Er habe eine Figur erfunden, schreibt David Diop im Nachwort, "die sich des negativen Bildes bewusst wird, das mit ihrer Negritude verbunden ist". Die Leser sollen sich fragen, worauf die Darstellung des "Anderen" in Konfliktsituationen eigentlich fuße.
Es geht in diesem Roman also weniger um realistische Kriegsdarstellung als um Belehrung. Alfa Ndiaye erscheint wie die plakative Ausgeburt eines Regietheatermachers, der allerhand Gedanken über das "Othering" und die Ideologie der Wildheit im Kopf hat - und womöglich auch auf die Kolonialverbrechen in Kongo anspielen will (wo den Sklaven oft als Bestrafung die Hände abgehackt wurden). Das alles mag gut gemeint sein, aber das Diskursive gewinnt Oberhand über die Darstellung, mit der Wirkung, dass die splatterhafte Grausamkeit der Beschreibungen aufgesetzt und ausgedacht wirkt. Das ist eine erstaunliche Schwäche des Romans angesichts des realen Kontextes - eines Schützengrabenhorrors, in dem doch fast jede Bestialität plausibel erscheint.
Der zweite Teil spielt in Senegal und rekapituliert Ereignisse aus der Jugendzeit von Alfa und Mademba. Ihre "Seelenbruderschaft" entwickelt sich aus der gegenseitigen Faszination zweier stereotyp entgegengesetzter Charaktere. Mademba ist ein Kopfmensch mit ungeschicktem mageren Körper, Alfa eine sportliche Kraftnatur. Es werden erste sexuelle Erfahrungen mit Frauen geschildert, und auch dabei bekommt man es mit einem gewissen Innereien-Tick zu tun, so dass sich nachträglich der Eindruck aufdrängt, bei dem Aufschlitzen der Leiber und dem Herausnehmen des Gedärms in den Kriegsszenen sei ebenfalls eine abartige sexuelle Note im Spiel.
Diops Sprache bemüht sich um einen rhythmisierten, litaneihaften, poetisch-archaisierenden Duktus. Eine Weile hat das durchaus Kraft, aber man könnte einwenden, dass dieser Stil klischeehaft afrikanisiere. Und wenn man zum hundertsten Mal die Floskel "bei der Wahrheit Gottes" lesen muss - der Autor flicht sie in jedem dritten Satz ein -, wird es geradezu nervtötend. Kurz: Dieser Roman verhebt sich an einem gewichtigen Thema. In Frankreich wurde er gleich mit mehreren bedeutenden Literaturpreisen ausgezeichnet.
WOLFGANG SCHNEIDER
David Diop: "Nachts ist unser Blut schwarz". Roman.
Aus dem Französischen von Andreas Jandl. Aufbau Verlag, Berlin 2019. 160 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Ein großes Stück Literatur über vergessene Kolonialgeschichte, den Krieg und das Menschsein!« Susanna Schürmanns Arte Metropolis 20191008