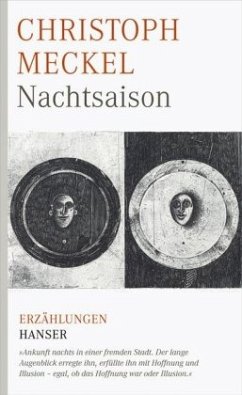Toby ist etwa neunzehn Jahre alt, genau weiß er es nicht. Er kennt nicht die Stadt, in der er lebt, sie ist zu groß. Er kennt nur das gesetzlose Leben in dieser Stadt. Sima, seine Schwester, ist der einzige Mensch für ihn gewesen, doch dann ist sie verschwunden. Eines Tages begreift Toby, dass auch für ihn hier kein Weiterleben ist. Christoph Meckel entwirft in seinen neuen Erzählungen eine nächtliche Welt jenseits der vertrauten. Die poetische Kraft seiner Erzählstimme zählt zu den eindrucksvollsten der deutschen Gegenwartsliteratur.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Einflüsterungen der Zentralheizung: Christoph Meckels Erzählungen wollen die Welt nicht abbilden, sondern beschwören. Der Autor aber verirrt sich in ihnen wie sein Held im fernen Moloch.
Drei der vierzehn Erzählungen dieses Bandes spielen in einer Stadt namens Montza. Sie hat nichts mit dem italienischen Monza oder mit irgendeiner anderen europäischen Stadt zu tun, auch wenn es in ihr einen Vasariplatz, eine Textorstraße und eine Schubert Hall, ein Coburg-Rondell und einen Newman-Prospekt gibt. Nein, Montza ist eine Metropole der Dritten Welt, ein "menschenverschlingender Koloss der Tropen", ein uferloser Urwald aus Stein. "Ihr fehlte ein Weltrand wie das Meer", heißt es in der Titelerzählung, stattdessen stinkt die Stadt aus allen Löchern: "Das quoll und dunstete durch die Straßen, staute sich um Kamine und Türme und war nicht der Smog der Vorkriegszeit." Ein Bürgerkrieg, so scheint es, hat Montza verwüstet, seine Banken- und Hotelpaläste ("gigantische Flipperkästen im leeren Raum"), seine Einkaufspassagen und Tunnelsysteme. Jetzt kämpfen Jugendgangs und Stadtguerrilla um die Herrschaft in den Straßenschluchten.
Dennoch kommt der Held der Erzählung "Ankunft in Montza", mit der das Buch beginnt, gern hierher. Er genießt das Chaos, den Lärm und die Hitze, denn er will darin eintauchen, mit der Fremde verschmelzen, um irgendwann weiterzureisen "ohne Verlustgefühl". Er will sich verlieren. Und das gelingt ihm. Als er nach einer langen Nacht in Bars und Clubs in sein Hotelzimmer zurückmöchte, merkt er, dass er den Namen des Hotels vergessen hat. Nur an die riesige Uhr, die über der Rezeption hängt, erinnert er sich. Aber im Zeichenlabyrinth von Montza ist das ein Indiz ohne Wert. Der Reisende, nun obdachlos geworden, wird zum Clochard. Nach drei Tagen bricht er in einem Rinnstein zusammen. Als er erwacht, sitzt er gefesselt in einer Hütte in den Slums. Der Familie, die ihn entführt hat, verspricht er den Inhalt seines Koffers samt Reisekasse, wenn sie ihn zu seinem Hotel zurückbringt. So suchen sie gemeinsam nach dem Foyer mit der großen Uhr.
Wer sich in einer Millionenstadt verläuft, hält nicht nach Sehenswürdigkeiten Ausschau. Er sucht nach Orientierungsmarken für die Rückkehr nach Hause. So ähnlich muss man auch Christoph Meckels Erzählungen lesen: mit einem wachen Blick für die Zeichen, die in den Geschichten versteckt liegen. Nur dass bei Meckel kein Weg zurück zum Ausgangspunkt führt. Seine Geschichten verlieren sich in der Welt, die sie entwerfen, wie der Reisende in Montza. Ein Menschenschmuggler bringt eine Frau von Lyon nach Berlin und kommt ihr dabei näher, als seine Aufgabe erlaubt; am Ende entdeckt er, dass sie die ganze Fahrt über gegen ihn gearbeitet hat ("Weiße Handschuhe"). Ein Mann will sterben und beauftragt einen Killer, überlegt sich die Sache aber anders und fährt ans Meer, wo sein Tod auf ihn wartet ("Clarion"). Meckels Geschichten kreisen, nicht erst in diesem Band, oft um das Unwiederbringliche, weil sie die Welt eigentlich nicht erzählen, sondern beschwören wollen. "Sie brauchten nicht viel außer Wasser in ihrer Nähe, eine Wärme, ein Licht, eine Trockenheit", heißt es über ein Liebespaar. Meckels Prosa braucht nicht mehr als einen beiläufigen Anlass, einen sprachlichen Zündfunken, dann glüht sie auf. Aber sie brennt nicht lange. Das ist die Kehrseite des Schreibens ohne Routenplan.
Christoph Meckel, 1935 geboren, ist eine Doppelbegabung reinsten Wassers. Als Dichter und Graphiker hat er vor gut fünfzig Jahren angefangen, und während er über die lyrische zur erzählerischen Form ("Licht") und zu autobiographischen Stoffen fand ("Suchbild"), wuchs das graphische Werk, Meckels "Weltkomödie", immer weiter an, sei es als Illustration oder als schöpferische Gegenbewegung zur Schriftstellerei. Auch Meckels neue Erzählungen sind graphisch in dem Sinn, dass sie nicht schnurgerade auf ein Ziel zulaufen, sondern mit vielen kleinen Bewegungen einen Erlebnisraum ausmessen, der zugleich innen und außen ist. In "Es ist", der schönsten Geschichte dieses Bandes, erinnert sich ein Mann an seine verstorbene Frau. Er versetzt sich in die Landschaften und Städte zurück, die er mit ihr gesehen, die Häuser, die er mit ihr bewohnt hat. Und immer wieder ist da die Sehnsucht, dies alles möge noch nicht geschehen, noch einmal in die Zukunft entrückt sein. "Es ist der Vorabend aller Tage, der leichtsinnig macht."
Die Nähe dieses hochgestimmten Schreibens zum Kitsch ist unübersehbar. Wo es misslingt, wo der Erzähler Tropen der Empfindsamkeit häuft und von Pinien, Ginster, Wolken und Weingärten raunt, wirkt es auf ungute Weise privat. Wenn sie aber die Balance zwischen Gefühl und Weltbeschreibung hält, beginnt Meckels Sprache zu klingen. Das harte Licht der Provence, wo der Dichter seit vielen Jahren lebt, dörrt seine Sätze auch syntaktisch aus, sie stoßen ihr Prädikat ab und werden zur Anrufung: "das Klickern der Steinlawinen, die Raubvogelschreie, der scheuernde Schnee." Diese Emphase, die jeden Herbstabend als Weltuntergang einfärbt, ist nicht jedermanns Sache, aber sie hat einen starken, eigensinnigen Ton.
Die Tücken der lyrischen Rede zeigen sich dort, wo auch ihr Gegenstand ins Lyrische und Schwankhafte kippt wie in den Moritaten und Tischgesprächen am Ende des Bandes. Es ist eben nicht wahr, dass "Geschichten ohne Pointe, Handlungen ohne Bedeutung" besonders "schön" sind, wie es einmal heißt - sie ruhen sich nur augenfälliger auf ihrer Schönheit aus. Bei allem Sprachfluss wird man doch den Eindruck nicht los, dass die Erzählungen vom dreckigen Jakob und dem frierenden Franz, vom Herumtreiber Windig und vom Wanderarbeiter Joel auch deshalb nirgendwohin führen, weil ihr Autor irgendwann die Lust an ihnen verloren hat, und so verliert man sie auch. Im Schlussstück, das eine Art Winterurlaubsprotokoll sein will, drängt sich die Ausdrucksmüdigkeit in die Sätze hinein: "Wir haben Tee getrunken, jetzt trinken wir Rotwein, dann kommt die Nacht." Leise rumpelt die Zentralheizung im Hintergrund.
Deutschen Erzählern, zumal solchen, die nicht mit historischen Stoffen oder Familiengeschichten hausieren gehen, wird oft vorgehalten, ihr Schreiben sei weltlos, nicht von Erfahrung und Recherche gesättigt. Mit der Titelgeschichte "Nachtsaison", die zugleich die längste des Bandes ist, will Meckel dieses Vorurteil widerlegen. Er erzählt von Toby, einem Jungen, der im Guerrillakrieg von Montza zu überleben versucht. Er streift ziellos durch die Stadt, findet seine Schwester Sima wieder, die aus den Verliesen des "Rattenkönigs", eines Jugendbandenführers, entkommen ist, richtet mit ihr ein inzestuöses Idyll im Obergeschoss eines aufgegebenen Hotelkastens ein und wird zuletzt von einer verirrten Kugel getroffen.
Es ist beinahe ein Roman, mit Skizzen der sterbenden Metropole, gelegentlichen Abstürzen ins Geleckte - die Geschwister sind "heiße, feuchte Menschentiere mit alten Augen, jungen Händen" - und einem knappen, drängenden Duktus. Aber nur beinahe. Denn ganz lässt sich Meckel nie auf die Geschichte ein. Wo es auf Einzelheiten ankäme, etwa bei der Schilderung der Unter- und Oberwelten von Montza, flüchtet der Erzähler in Allgemeinheiten. Die Stadt ist "ein altes Gebiss", bewohnt von "Schmerzmenschen", aber wir lernen sie nicht kennen. Auch Toby, der Held, wird wieder weggezaubert, ehe er richtig Kontur bekommen hat. Und so bleibt die Stadt mit dem Vasariplatz und dem Newman-Prospekt, was sie immer gewesen ist: ein Konstrukt. Der Reisende, der auch der Erzähler dieses Buches ist, hat sich in ihr verloren, ohne die Geschichte zu finden, für die sich die Fahrt gelohnt hätte. Seine Ungeduld zieht ihn weiter, fort in die nächste fremde, rätselhafte, unsichtbare Stadt.
ANDREAS KILB
Christoph Meckel: "Nachtsaison". Erzählungen. Hanser Verlag, München 2008, 255 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Helmut Böttiger stellt zwei neue Bücher von Christoph Meckel vor, die nach Ansicht des Rezensenten unterschiedlicher nicht sein könnten. Dieser Band mit Erzählungen zeigt ihm den Autor von zwei Seiten: Der erste Teil zeichnet sich durch eine auffällige Abwesenheit von "Subjektivität" aus, und die durch Megacities stolpernden, verlorenen Figuren erinnern in ihrer Stilisierung stark an das grafische Werk des Autors, findet der Rezensent. Im zweiten Teil dagegen überwiegen die "frei umherschweifenden" Charaktere und der "verspielte, zauberische" Ton des Frühwerks, der allerdings mit den Jahren melancholischer geworden ist, wie Böttiger meint. Insgesamt arbeite der Autor mit seinem "erprobten Bildervorrat", er scheue aber nicht das Wagnis, in seinen Erzählungen die "Sehnsüchte zu mischen", wie der Rezensent anerkennend feststellt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH