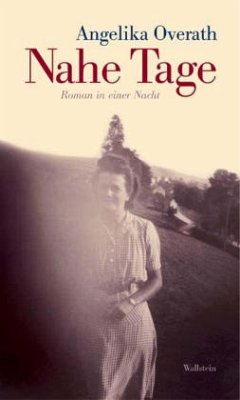Johanna steht am Bett ihrer toten Mutter und hört, wie sie atmet. Mit dieser Sinnestäuschung beginnt die Inventur einer Kindheit. Den Plastiksack mit den letzten Habseligkeiten der Verstorbenen in der Hand, verläßt Johanna das Krankenhaus, in das sie zuletzt täglich von ihrem 100 Kilometer entfernten Wohnort aus angereist war. Nun kehrt sie zurück in die mütterliche Wohnung, in der sie selbst vor langer Zeit einmal gelebt hat. Zwanghaft sortiert sie die Textilien nach Temperaturverträglichkeit, und während das Wasser in die Waschmaschine läuft und die Trommel zu rotieren beginnt, werden kaum beachtete alltägliche Dinge zu Auslösern für die Erinnerung an vergessene Wörter und Erlebtes. Früher Selbstverständliches wie die tägliche Fahrt von Mutter und Tochter zum Grab des Großvaters erscheint nun in einem unheimlichen, verstörenden Licht. Und überhaupt wird plötzlich fragwürdig, was einmal so harmonisch wirkte zwischen den beiden. Die Genauigkeit und die bohrende Intensität, mit der Angelika Overath ihre Protagonistin die verschütteten Erinnerungen zur Sprache bringen läßt, gibt eine Ahnung davon, wieviel Ungesagtes darin mitschwingt. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit den Geschichten aus dem Sudetenland, die Mutter und Großmutter seinerzeit mehr verschwiegen als erzählt haben.Johanna, die immer wieder versucht, die Wohnung zu verlassen, sitzt gespenstisch fest - bis sie gegen Mitternacht eine Pizza bestellt und die Pizzabotin Svetlana, eine rußlanddeutsche Lehrerin aus dem Kaukasus, sich zu ihr an den Küchentisch setzt.

Angelika Overaths verstörender Roman über Mutter und Tochter
Der Verlust der Mutter trifft den Menschen ungeachtet seines Alters immer als Kind. Alle Weltgewißheit, alles Weltempfinden, ja alles Weltvertrauen gerät einen Augenblick ins Wanken angesichts der mütterlichen Ungeheuerlichkeit, tatsächlich sterblich zu sein. In "Nahe Tage", dem verstörend berührenden Romandebüt von Angelika Overath, trifft diese skandalöse Tatsächlichkeit das vierzigjährige Kind Johanna mit derartiger Wucht, daß sich ihrer zunächst nur ein betäubendes Erstaunen bemächtigt. "Ihr Tod war gegen ihrer beider unausgesprochener Abmachung, war gegen das ganze selbstverständliche Lebensprinzip."
So wie einst ihrer beider dyadisches Dasein mit dem hechelnden Atem der Mutter begann, der das nie abgenabelte Kind ins Leben trieb, mühte Johanna sich neun Tage lang in einem lindgrünen Krankenzimmer, ihre sterbende Mutter ins Leben zurückzuatmen. Vergebens.
Die elende Zeit der Trauer wird folgen, doch konzentriert sich die Autorin allein auf diesen ersten Tag, diese erste Nacht des Mutterseelenverlassenseins, die für die haltlose Johanna nur eine Zeit des tastenden Nachspürens sein kann. Wo kein Weg in ein Weiter drängt, führen Johannas Füße sie Schritt um Schritt zur Wohnung der Mutter, einen Plastiksack mit deren letzten Habseligkeiten schwer im Arm, und dann hinein in die abgestandene Heimeligkeit der Käthe-Kruse-Puppen, Porzellanrehe, Plüschkatzen, bestickten Kissen und Streublümchen auf Wachstuchtischdecken und Tapeten. Hier verbringt sie die Nacht zwischen aufsteigenden Bildern einer Kindheit, die nach dem Willen der Mutter nie hätte aufhören sollen.
Denn dies ist keine der oft gelesenen Mutter-Tochter-Konfliktgeschichten, sondern eine Geschichte von Mutter und Kind. "Du bist aus mir herausgekrochen, du wirst immer mein Kind bleiben" - Sätze wie dieser sollen das zehnjährige Kind an den Mutterschoß ketten, als dieses es wagt, Freundinnen zu haben. Die erstickende Schlingpflanzenliebe der Mutter duldet keine Konkurrenz, noch die erwachsene Johanna scheint eigentümlich verdorrt, als habe sie sich von der gewalttätigen Mutterliebe nie erholt.
In lakonischer Behutsamkeit zeichnet Angelika Overath ohne einen einzigen überflüssigen Strich Szenen eines freudlosen Mikrokosmos in den fünfziger Jahren. Da stopft die Kittelschürzenhausfrau das pummelige Kind mit gezuckerten Dosenpfirsichen und schokoladig verkleistertem "Kalten Hund", da weint der selbstmordgefährdete Vater am Frühstückstisch, und nur das stur tapfere Weiteressen des Kindes hält die Ordnung der Welt aufrecht. Seine Frau schüttelt ob seiner dilettantischen Selbstmordversuche den Kopf, ("er war doch Industriemeister"), nutzt aber selbst Drohungen als drastisches Mittel, der Heranwachsenden einen mutterfreien Schwimmbadbesuch auszureden. Ihr Lieblingslied ist leicht zu erraten: "Mamatschi", da stirbt zuletzt die gute Mutter - das hat der treulose Sohn mit seinen ewigen Pferdchenforderungen nun davon.
Ergänzt wird diese unglückselige Dreierkonstellation aus schwachem Vater, verlustangstgeplagter Mutter und familienkittendem Heilsbringerkind durch zwei Trabanten: eine bei der Familie lebende Großmutter, deren größtes Verdienst es ist, wie die Mutter von "Zuhaus", aus dem Sudetenland, vertrieben worden zu sein, und den abgöttisch geliebten verstorbenen Vater der Mutter. Und es sind eben dieser tote himmlische Vater, die schmerzensreiche Tochtermutter, die, wie wir zu vermuten wagen, zu ihrem großen Bedauern nicht jungfräulich empfangen konnte, und das Kind, die hier die wahre Triade eines heiligen Familienideals bilden. "Ihre Mutter jedenfalls war nie eine Frau geworden, nicht einmal, als sie ein Kind gebar. Sie war die traurige Tochter geblieben, die ihr kleines Kind täglich zum Grab des Vaters brachte." Ginge es nach dieser stets zu Tränen neigenden Mater dolorosa, müßte der Status quo ewig aufrechterhalten werden. So schamhaft Sexualität gehandhabt wird, so geradezu unverschämt gerne malt das Mutteropfertier dem kleinen Mädchen ihr blutiges Zerrissenwerden während der von nachgerade biblischen Schmerzen begleiteten Sturzgeburt aus.
Alle Veränderung, jede Entwicklung, jede Auseinandersetzung kann die Mutter nur als Gefahr begreifen, wo sie sich nach dem unwiederbringlichen Verlust des "Zuhaus" doch in diesem Kinde eine zweite, mobile Heimat geschaffen hat: "Das Kind war zum Haus der Mutter geworden." Damit diese pathologische Symbiose fortbestehen kann, sucht die Mutter das kleine Mädchen infantil zu halten, und wischt noch der gut Neunjährigen in Fortführung des Wickelns den Po ab, wäscht sie abends auf dem Küchentisch, weil sie angeblich "wund" sei. Diese und ähnliche Intimitätsverletzungen, auch als geistiges Eindringen - die Mutter liest heimlich Johannas Tagebücher -, bilden ein immer wiederkehrendes Motiv in den aufsteigenden Erinnerungen der frisch verwaisten Tochter. Auf Szenen des Aufbegehrens hofft man vergebens. Johanna beugt sich den Gesetzen Einheit, Reinheit, Mütterlichkeit der staubwedelnden "Königin der Einbauküche".
Angelika Overath setzt ihre stets unsentimentalen Sätze auch in diesem Werk mit der klugen Klarheit, über die man sich bereits in ihren beiden Reportagesammlungen freuen durfte. Doch scheint ihre Sprache in "Nahe Tage", für das ihr der Thaddäus-Troll-Preis verliehen wurde, noch dichter, da bleibt keinerlei Platz für entspannte Plaudereien oder füllende Mörtelworte, lückenlos fügt sich ein präziser Satz an den nächsten. Daß Overath ihren Figuren so schmerzhaft nahe sein kann, mag an autobiographischen Elementen liegen - auch ihre Mutter war eine Heimatvertriebene mit einem böhmisch-mährischen "Zuhaus", das Angelika Overath und ihren Vater zu Fremden machte, die "nur irgendwo geboren worden waren", wie sie im Epilog ihres Reportagebuchs "Das halbe Brot der Vögel" schrieb. Vielmehr gelingt ihr diese Nähe aber wohl wegen des nie wertenden, aber schonungslos genauen Blicks, den sie auf diese zwanghafte Zweisamkeit wirft.
Die sprachlose Leere, die dem schmalen Buch von Anfang bis Ende entströmt, verschulden Mutter und Tochter gleichermaßen. Was über das Unausgesprochene zwischen den beiden Frauen nicht gesagt wird, kann auch nicht gesagt werden, weil diese beiden dafür keine Worte haben. Man ahnt zuweilen den vagen Ekel vor der aufdringlichen Körperlichkeit der Mutter, spürt die unterschwelligen Aggressionen. Doch die unreflektierte Perspektive des gerade verlassenen Kindes läßt weder impulsive Ausbrüche noch eine distanzierte Analyse ihrer beider Verhältnis zu. Man würde sie der erwachsenen Johanna, über die man kaum mehr erfährt, als daß sie selbst weder Kind noch Mann hat und als Bibliothekarin gegen ihre Neigung für Kinderbücher zuständig ist, auch nicht zutrauen. Was bleibt, ist eine achselzuckende Stille. Wirklich gesprochen haben die beiden nie, nun ist es zu spät. Die Mutter atmet nicht.
SABINE LÖHR
Angelika Overath: "Nahe Tage". Roman in einer Nacht. Wallstein Verlag, Göttingen 2005. 151 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Beeindruckt zeigt sich Rezensentin Sabine Löhr von Angelika Overaths "verstörendem" Debütroman "Nahe Tage". Die Geschichte einer Mutter, die ihr Kind mit gewalttätiger, schlingpflanzenartiger Liebe an sich bindet, ohne je in der Lage zu sein, mit der Tochter wirklich zu sprechen, und deren Tod, die Tochter in einen Art Schockzustand versetzt, hat Löhr sichtlich berührt. Sie lobt die "lakonische Behutsamkeit", mit der Overath Szenen einer unglückseligen familiären Dreierkonstellation aus schwachem Vater, verlustangstgeplagter Mutter und familienkittendem Heilsbringerkind zeichnet. Overaths Sätze findet sie stets "unsentimental" und von einer "klugen Klarheit". Überhaupt erscheint ihr Sprache in diesem Roman noch "dichter" als in Overaths beiden Reportagesammlungen. Hier bleibe "keinerlei Platz für entspannte Plaudereien oder füllende Mörtelworte, lückenlos fügt sich ein präziser Satz an den nächsten".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
'Alles unterliegt bei Angelika Overath dem unbestechlichen, genauen Blick. Die Sprache ist poetisch, weil sie genau ist, jedes Wort entspricht, ohne falsche Rücksichtnahme, der beschriebenen Gegenwart.'(Oliver Vogel, Süddeutsche Zeitung)'In lakonischer Behutsamkeit zeichnet Angelika Overath ohne einen einzigen überflüssigen Strich Szenen eines freudlosen Mikrokosmos in den fünfziger Jahren. (.)Angelika Overath setzt ihre stets unsentimentalen Sätze auch in diesem Werk mit der klugen Klarheit, über die man sich bereits in ihren beiden Reportagensammlungen freuen durfte'(Sabine Löhr, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.2.2006)