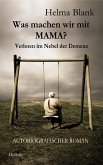Ein gescheiterter "Theatermann", einst eine Legende, sieht sich mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert. Die Zeit, die ihm bleibt, widmet er dem "Versuch, dem großen Widersacher in die Karten zu schauen, den Kampf auf diese Weise ausgeglichener zu machen und die Niederlage erträglicher". Flüchtigste Blicke und leiseste Gesten erhalten plötzlich Bedeutung, das Leben behält bis in die letzten Momente Intensität und Kraft und holt seine Spannung aus den kleinsten Nuancen der noch möglichen Wahrnehmung. Zwischen unbändigem Lebenswillen und Lust an der Selbstaufgabe schwankend, reflektiert der Ich-Erzähler über sein Leben und erkennt, dass selbst aus der Perspektive des Todes die Lebenslügen ihre Macht behalten: "Sich selbst von Grund auf zu kennen, kann nur schrecklich sein, es hieße, Bilanz zu ziehen und für immer aufzugeben." Dennoch versucht er den Bann zu brechen und begibt sich auf eine existenzielle Suche nach der verlorenen Zeit; er führt den Leser in eine Zone, die noch niemand betreten hat und lässt ihn verändert zurück.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Carl-Henning Wijkmarks großes kleines Krankenbuch
Gemeinhin folgt man Ich-Erzählern gern in ihre Gedankenwelten. Jedenfalls dann, wenn sie entsprechend packend erzählen können. Zu wissen, dass der Erzähler seinem baldigen Tode entgegendenkt - wie in Carl-Henning Wijkmarks Roman "Nahende Nacht" - erfordert hingegen ein besonderes Vertrauensverhältnis. Was, wenn er uns in Abgründe zieht, die wir jetzt noch nicht erkunden wollten? Hasse, die Hauptfigur im neuen Roman des 1934 geborenen Schweden, macht es uns leicht. Er umgibt sich schon zu Beginn seines letzten Krankenhausaufenthaltes mit klugen Büchern über die Kunst des Sterbens. Das schafft ein wenig Sicherheit. Und eben weil es so leichtfällt, ihm zuzuhören, gibt man ihn am Ende dieser kleinen Sterbensnovelle so ungern her.
Seine Erzählerposition ist so haltlos wie seine Lage. Man wundert sich nicht einmal, wie er das alles hat schreiben können, wo er doch am Ende sogar seine sterbliche Hülle verlässt: "versuche, die Beine über die Bettkante zu heben, aber ein riesiges Gewicht presst sie fest. Es ist kalt. Will den Arm heben, um Licht zu machen, aber er rührt sich nicht. Das ist alles. Nie mehr." Auch die Realität gibt bekanntlich keine Todesberichterstatter her. Was diesen hier dennoch so vertrauenswürdig macht, ist nicht seine Belesenheit, sondern seine entwaffnende Offenheit. So radikal hat zuletzt vielleicht Philip Roth in seinem Roman "Jedermann" (2006) über das Verlöschen geschrieben; wie sich dessen Protagonist minutiös von einem Totengräber die Prozedur des Ausschaufelns erklären lässt, gehört zu den ergreifendsten, rätselhafterweise sogar zu den beruhigendsten Szenen der jüngsten Literaturgeschichte über dieses Thema.
Wijkmark ist, ästhetisch gesehen, genauso konsequent. Als Autor, der mit seinem Buch "Der moderne Tod" (1978) schon früh die Überalterung thematisierte und sich in seiner Heimat Schweden an der Debatte um Sterbehilfe beteiligt (F.A.Z. vom 22. August 2009), verfolgt er aber noch ein anderes Ziel: das Sterben in Krankenhäusern aus der Sicht des Betroffenen zu schildern.
Wijkmark gestaltet diese letzte Lebensphase nicht als geradlinige Talfahrt. Es gibt Höhepunkte - Georg, der den Bücherwagen des Hospitals schiebt; das Herein- und Hinausschweben der Schwestern; traumartige, prächtige Farben, die das Morphium dem Todkranken beschert. Und es gibt Momente, wenn Hasse statt in Farben in tiefere, meditative Zustände versinkt. Dann tauchen Menschen aus der Vergangenheit auf, ja, es kommt "zu regelrechten Themenabenden", zu Gesprächen, denen er lauscht, ohne selbst mitzureden. Nur einmal geht ein Ruck durch die Erzählung, als sich die beiden Mitsterbenden, mit denen Hasse noch zuvor gern über den Tod debattierte, nachts von der Schwester ein Festmahl servieren lassen. Mit Wodka trinken sie sich entschlossen in den Tod. Danach ist Hasse sich selbst überlassen, wiegt Jenseitsvorstellungen des ägyptischen gegen das tibetische Totenbuch ab, um sich abzulenken - und beobachtet: wie man darauf wartet, dass auch er das Zimmer räumt, weil das die Kosten senkt; wie seine Lebenskraft kommt und geht und warum; wie jetzt öfters geputzt wird; und wie in diesen spätherbstlichen Tagen erst eine Taube, dann eine Fledermaus durchs offene Fenster flattert. Es wird nie direkt ausgesprochen. Aber man ahnt, dass die liebreizende Schwester Angela auch mehr im Angebot hat als die vorgesehene Schmerzmitteldosis.
"Nahende Nacht" ist geschrieben wie ein wundersamer Traum mit wachen Episoden. Die Welt wird zwar enger. Aber dabei erzählt sich in fließender und genauer Sprache nicht der Tod, sondern das Leben, während man es zugleich hinter dem Vorhang verschwinden sieht - wie den ehemaligen Theatermann Hasse früher auf der Bühne. Hasse federt zwischen allem und bezieht keineswegs eindeutige Positionen. Mal wundert ihn das "Verbrauchen und Wegwerfen" des menschlichen Lebens, und er will eine zweite Chance; dann wieder darf es ruhig schmerzgelindert verglühen.
Wijkmark spart das Körperliche nicht aus. Er zieht es ein wie die zwingende Handlungsebene eines Dramas, bei dem wenige Requisiten ausreichen, um das Leiden aufzurufen: die "Sandpapierzunge" oder "diese qualmende Trockenheit, der Rauch, der mit meinem Körper abzieht". Als löse er uns selbst aus diesem Drama sanft heraus, begleitet er seinen zum Sterben sich bereithaltenden Mann ohne Eile in jenen anderen Zustand; durch "kurze Schübe einer eiskalten Todesangst", wenn die Kraft es zulässt; aber schließlich auch hinein in eine "Vereinfachung", vor der sich alles verflüchtigt. Je mehr Hasse dank seiner zähen Widerständigkeit dieses Hasch-mich-Spiel mit dem Tod durchschaut, desto mehr Gewicht scheint von ihm abzufallen.
Man mag das alles als wohlgelauntes Sterbecapriccio im Reich der alles erlaubenden Fiktion aufnehmen. Lieber will man sich aber verbeugen vor der Radikalität dieser in ihrem Minimalismus so prägnanten Erzählung. Wijkmark, der für dieses Buch 2007 den bedeutendsten schwedischen Literaturpreis, den August-Preis, erhielt, weicht die Komplexität des Themas nicht auf. Und womöglich liegt es sogar gerade an jenem reflektierenden Tonfall, dass einem bisweilen die Kehle eng wird. Bei aller Darstellung verschiedener Positionen überwiegt immer die Nähe zur Figur. Wijkmark lässt sie niemals fallen, während er sie - fast zärtlich und alle Launen verständnisvoll hinnehmend wie die beiden Krankenschwestern - durch die Einsamkeit dieser letzten Lebensphase geleitet.
ANJA HIRSCH
Carl-Henning Wijkmark: "Nahende Nacht". Roman.
Aus dem Schwedischen von Paul Berf. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2009. 154 S., geb., 17,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Florian Kessler steht Carl-Henning Wijkmarks Roman über das Sterben eines ehemaligen Schauspielers mit Staunen und auch Befremden gegenüber. Der schwedische Autor lässt in einem großen Monolog den Sterbenden seinen Verfall und ebenso seine Umgebung aus Ärzten, Schwestern und Angehörigen aufzeichnen und das "Zwischenreich" zwischen Lebensgeschichte und nahendem Tod ausloten, erklärt der Rezensent. Leidenschaftliche Verurteilung der Sterbehilfe wie überhaupt des "verwalteten Sterbens" der Gegenwart schreibt Kessler dabei sowohl dem Autor wie dem Helden zu. Das eigentliche Zentrum des Romans aber sei der Versuch, dem Tod "in die Karten zu schauen", indem der Sterbeprozess minutiös beobachtet und reflektiert wird. Worüber sich Kesser nur wundert: dass dies derart "weihevoll" und unter pietätvoller Ignorierung der "körperlichen Realitäten" passiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH