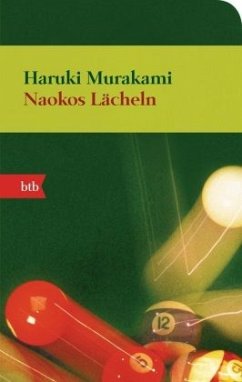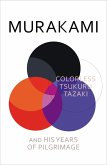Die Geschenkausgabe mit der abgerundeten Ecke: anspruchsvolle Haptik, hochwertiges Papier, mit Lesebändchen, kleines Format.
Tokio in den späten 60er Jahren: Während sich auf der ganzen Welt die Studenten versammeln, um das Establishment zu stürzen, gerät auch das private Leben von Toru Watanabe in Aufruhr. Mit seiner ersten Liebe Naoko verbindet ihn eine innige Seelenverwandtschaft, doch ihre Beziehung ist belastet durch den tragischen Selbstmord ihres gemeinsamen Freundes Kizuki. Als die temperamentvolle Midori in sein Leben tritt, die all das ist, was Naoko nicht sein kann, muss Watanabe sich zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiden ...
Tokio in den späten 60er Jahren: Während sich auf der ganzen Welt die Studenten versammeln, um das Establishment zu stürzen, gerät auch das private Leben von Toru Watanabe in Aufruhr. Mit seiner ersten Liebe Naoko verbindet ihn eine innige Seelenverwandtschaft, doch ihre Beziehung ist belastet durch den tragischen Selbstmord ihres gemeinsamen Freundes Kizuki. Als die temperamentvolle Midori in sein Leben tritt, die all das ist, was Naoko nicht sein kann, muss Watanabe sich zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiden ...

Haruki Murakami langt nach den Frauen und greift daneben / Von Rose-Maria Gropp
Toru Watanabe ist ein Mann von siebenunddreißig Jahren. Er sitzt in einem Flugzeug, das gerade in Hamburg gelandet ist. Eine Instrumentalversion von "Norwegian Wood" wird als Hintergrundmusik eingespielt. Das Lied von den Beatles funktioniert für ihn offenkundig wie einst die Madeleine für Proust. In "Naokos Lächeln" geht es direkt zur Sache mit dem heiteren Literaturraten, den ungenannten und den offenen Anspielungen. "Norwegian Wood" als Erinnerungskeks: Nach diesem Wiederhören fängt der erwachsene Mann an, über sich selbst als jungen Mann in der Ichform zu schreiben. Ohne jeden Abstand tut er das; man könnte von Regression sprechen. Mit dieser Distanzlosigkeit in der Selbstbeschreibung katapultiert sich der Autor - um es vorweg zu sagen, das gesamte Buch hindurch - aus genau der erzählerischen Tradition hinaus, die er beständig, verdeckt oder direkt, zitiert.
Das Spiel mit Buchtiteln, die den gebildeten Leser eines belesenen Autors in die Spiegelwelten der kanonischen Literatur vom Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts treiben, ist schon hübsch. Aber wo diese Texte, wie Fitzgeralds "Der große Gatsby" oder Joseph Conrads "Lord Jim", als veritable Stimmungskanonen funktionieren, die den Icherzähler auf doppelter Ebene identifikatorisch in eine Ahnenreihe hineinschießen - den jugendlichen Toru Watanabe in die Nähe der altvorderen Protagonisten, den Autor Murakami in die Nähe der Nobelpreisträger -, wird die Angelegenheit allzu durchschaubar. Denn es findet keine Vermittlung der Ebenen statt, nur Kurzschlüsse sprühen Funken.
Es handelt sich bei "Naokos Lächeln", in Japan bereits 1997 erschienen und in Amerika im letzten Jahr, um eine Art gescheiterten Entwicklungsroman, in dem das Verhältnis zu den Frauen eine entscheidende Rolle spielt. Da ist die familiär vorbelastete und früh seelisch beschädigte Naoko, die am Dasein unter den Menschen zerbricht. Eine zentrale Passage des Buches führt Toru in eine Gebirgsgegend in das einer Landkommune ähnlich organisierte Sanatorium, das Naoko vorübergehend lebensfähig hält: Zur zerrütteten Geliebten reist Toru nicht ohne Thomas Manns "Zauberberg" im Gepäck. Da ist Midori, die früh die Härte des Lebens erfahren mußte und deren fiebrige Lebendigkeit sich in übersexualisierte Phantasien ergießt: Kein Wunder, daß Toru in einer Nacht in ihrem Haus Hermann Hesses "Unterm Rad" liest. Da ist endlich die fast zwanzig Jahre ältere Reiko, die mit Naoko im Sanatorium wohnt; ihr Leben ist von Musik bestimmt, sie allerdings scheint den "Zauberberg" zu kennen, und von Toru fühlt sie sich an - wer hätte es geahnt - Salingers Fänger im Roggen erinnert.
Murakami stellt einleitend klar, was sein studentischer, einzelgängerischer Protagonist in jenen Jahren der von ihm verachteten Revolte zwischen 1968 und 1970 liest, als Achtzehn- bis Zwanzigjähriger - Capote, Updike, Fitzgerald, Chandler: "Allerdings sah ich nie jemand anderen auch solche Bücher lesen, weder im Seminar noch im Wohnheim." Denn "die meisten schätzten Kazumi Takahashi, Kenzaburo Oe, Yukio Mishima oder moderne französische Schriftsteller". Toru Watanabe kann schon der Duft eines einzigen Buches, die Berührung der Seiten glücklich machen. Es geht Murakami um die Unterscheidung des einzelnen von der Masse - eine wohlbekannte Attitüde. Man vermißt aus den Arsenalen des Westens den "Steppenwolf". Und unter den japanischen Autoren sollte ihm nicht wenigstens Mishima aufgefallen sein?
Ist da doch eine merkwürdige Koinzidenz: "Am Morgen des 4. Januar 1925 hatte meine Mutter ihre ersten Wehen und um neun Uhr abends brachte sie ein Kind zur Welt, das nur knapp fünf Pfund wog." Es ist Yukio Mishima, der 1949 sein autobiographisch untergründetes "Geständnis einer Maske" mit diesem Geburtsdatum einleitend ausstattet. Murakami läßt seinen 1992 in Japan erschienen Roman "Gefährliche Geliebte", der in deutscher Sprache im vergangenen Jahr erschien und kontrovers aufgenommen wurde, mit den Sätzen beginnen: "Ich bin am 4. Januar 1951 geboren, in der ersten Woche des ersten Jahres der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Eine denkwürdige Konstellation, nehme ich an, und darum gaben meine Eltern mir den Namen Hajime - japanisch für ,Beginn'." Man darf wohl den Intertext-Fanatiker Murakami, Jahrgang 1949, nicht für derartig unwissend halten, daß ihm Mishimas Schlüsselwerk unbekannt sein könnte. Mißt man dieser Übereinstimmung in der Exposition eine Bedeutung zu, dann hätte Murakamis Machwerk "Gefährliche Geliebte" eine versteckte Folie, die erklären könnte, warum er seine Dreiecksgeschichte nur so heuchlerisch beenden kann. Ein wenig unlauter darf man Murakamis Maskerade auch finden.
Das kryptische Spiel mit dem Geburtsdatum (weder Mishima noch Murakami sind am 4. Januar geboren) fügt auch "Naokos Lächeln" - dem in der Tat früheren und verhältnismäßig besseren Buch - eine weitere verschwiegene, literarische Genealogie hinzu: Man muß nicht den alten Familienroman des Neurotikers bemühen, um für Murakami ein prismatisch glitzerndes Größen-Ich festzustellen, das mit Selbstverschleierung und -enthüllung kokettiert. Wieder dominiert das Prinzip der Triangulierung als Hintergrund für die Suche nach Identität. Schauplatz dieser Selbstbesichtigung ist für Murakami die Sexualität, eine verquaste und schlüpfrige Erotik in ständiger Todesnähe. Was dem Leser auf diesem Terrain - jedenfalls in deutscher Übersetzung; die amerikanische, von Murakami autorisierte Übertragung unter dem Titel "Norwegian Wood" ist etwas erträglicher - geboten wird, ist ein Schlag ins Kontor genau der literarischen Portalsfiguren, die das Buch so sorgfältig wie schützend aufstellt. Denn ihnen ist eben der Exibitionismus fremd.
Murakamis streckenweise gelungene Prosa, die Natur und Urbanität romantisierend der Stimmung des Helden unterwirft, wird auch nicht plausibler, wenn man den zur Leitmetapher erhobenen Popsong betrachtet. "I once had a girl or should I say she once had me", der berühmte Anfang von "Norwegian Wood", ist nur Behauptung. Alle Verspieltheit ist dem Lied - und damit der im Buch allenthalben beschworenen westlichen Popkultur - ausgetrieben. Es bleibt der Bierernst, der einen Postpubertären nicht aus seinen Fixierungen auf die klassischen Teilzonen des weiblichen Körpers entläßt, bei musikalischer Untermalung.
Der Wiederholungszwang, den sich die Fabel leicht hätte zunutze machen können, wird zur refraingleichen, in nichts gefilterten Phantasie eines an- und abschwellenden Begehrens. Die Lieder der Beatles und anderer Popgrößen jener Zeit möblieren nur schwüle, regressive Träume. Diese Erziehung des Herzens zur Sentimentalität tastet perfekte Körper junger Frauen im Mondlicht ab. Das kann man machen. Man soll diese Gemütsverfassung nur nicht als Existentialismus ausgeben, der seine besten Zeiten längst gesehen hat. Das hat Haruki Murakami in Japan den Status eines Kultautors, eines Händlers der Lebensgefühle, eingebracht.
Von Übersetzungen läßt sich besonders schwer handeln. Wenn dann freilich dabei Katastrophen passieren, ist man um so stärker irritiert: Leitmotivisch taucht in "Naokos Lächeln" der namenlose, stotternde und wegen seines Sauberkeitsfanatismus als "Nazi" apostrophierte Zimmergenosse Torus auf, der eines Tages spurlos verschwunden ist, ein weiterer Toter in diesem Panoptikum von Todgeweihten. Konnte denn im deutschen Verlag niemand lektorierend und mit einem Minimum an historischen Grundkenntnissen ausgestattet den unguten Spitznamen dieses Unglücklichen als "Sturmbannführer" erkennen? Er wäre doch nur aus der englischen Übersetzung "storm trooper" sinnvoll ins Deutsche zu übertragen gewesen. Daß der beschränkte Junge im Wohnheim, mit dessen Eigenheiten sich selbst Naoko erheitern läßt, im ganzen Buch als "Sturmbandführer" (sic!) auftaucht, ist ein Armutszeugnis, das jedes Vertrauen verlieren läßt in Kompetenz und Sorgfalt.
Schließlich: Selbst wenn der willige Leser sich Murakamis Mut zum radikalen Kitsch anvertrauen würde - durch einen solchen Faux pas muß er sich ausgesetzt finden auf den bittersüßen Bergen des Herzens (Rilke). Heißt doch die leitende Erkenntnis des Buches ohnehin, altklug genug: "Der Tod verkörpert nicht das Gegenteil des Lebens, sondern ist ein Bestandteil desselben."
Am Ende geschieht das Absehbare: Toru schläft mit der wesentlich älteren Reiko, versinkt in ausführlicher Schilderung in ihre faltige Haut wie in einen edlen Kimono. Wahrscheinlich, weil sie vorher zu ihm gesagt hat: "Ich bin eine menschliche Musikbox." Nach fünfzig, Toru auf der Gitarre vorgespielten Popsongs als intimes Pomp funebre für Naoko hat sie wohl ein Recht dazu. Der Icherzähler stellt dabei einen persönlichen Beischlafrekord auf. Es bleibt nur noch, ihm zu dieser schönen Anstrengung zu gratulieren, die ihn offenbar in nichts mit sich selbst bekannt gemacht hat (Kleist). Solcherart gereift ruft er die unerfüllte Midori an, eröffnet das nächste Dreiecksspiel: "Auf der ganzen Welt will ich nichts außer dir. Ich will dich sehen und mit dir reden. Ich will, daß wir beide noch einmal ganz von vorn anfangen." Bloß nicht.
Haruki Murakami: "Naokos Lächeln. Nur eine Liebesgeschichte". Roman. Aus dem Japanischen übersetzt von Ursula Gräfe. Dumont Buchverlag, Köln 2001. 428 S., geb., 46,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main