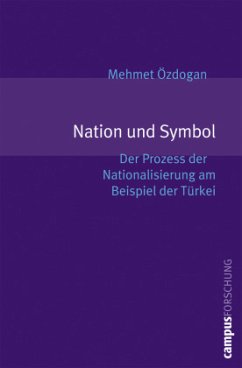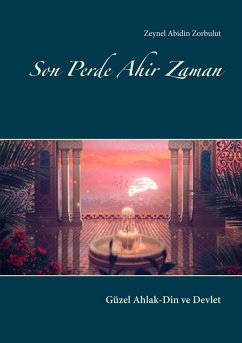Campus Forschung
Obwohl die Nation ein Ergebnis historisch relativ neuer gesellschaftlicher Entwicklungen darstellt, besitzt dieses Konzept den Schein natürlicher Gegebenheit und eine hohe emotionale Attraktivität. Am Beispiel der Türkei beleuchtet der Autor die soziologischen und psychoanalytischen Aspekte von Nationalisierungsprozessen. Nationale Muster der Selbst- und Fremdwahrnehmung spielen dabei ebenso eine Rolle wie emotional stark aufgeladene sprachliche und visuelle Symbole.
Inhaltsverzeichnis:
Danksagung
Einleitung
Teil 1: Zur Kritik des Nationalismus
1.1 Nationsverständnis
1.1.1 Nationsverständnis in traditionellen Nationalismustheorien
1.1.2 Nationsverständnis in modernen Nationalismustheorien
1.1.3 Exkurs: Nation als intermediäre Institution
1.2 Symbol und nationale Vergesellschaftung
1.2.1 Zur Versprachlichung des Sakralen
1.2.2 Zur Wirkungskraft der Verbildlichung
Teil 2: Nationalisierung der Gesellschaft in der Türkei
2.1 Vom Reich zum Nationalstaat
2.2 Schrift und Sprache der Nation
2.3 Sprache und religiöser Kult
2.4 Bilder der Nation
2.4.1 Architektur und Städtebau
2.4.2 Kleidung
2.4.3 Musik und Tanz
Schlussbetrachtung
Literatur
Leseprobe:
Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Einblick in die gesellschaftlichen Strukturen des Osmanischen Reichs bis zur Ausrufung der Türkischen Republik. Es werden in groben Zügen der Niedergang des Reichs und die Staatsgründung der Türkischen Republik mit ihren ersten staatsrechtlichen Umstrukturierungen skizziert. Dies dient dem Ziel, den im 19. Jahrhundert ansetzenden gesellschaftlichen Wandel darzustellen, um die Frage nach den subjektiven Konstitutionsbedingungen des Nationalismus in der Türkei in einen Gesamtzusammenhang einordnen zu können.
In einem ersten Schritt werden einige Aspekte der Sozialstruktur und Staatsordnung des Osmanischen Reichs umrissen. Im zweiten Schritt folgt eine Zusammenfassung der ersten Reformversuche, die das Herrscherhaus im 19. Jahrhundert zur Rettung des zerfallenden Reichs eingeleitet hat: die Tanzimat. Um die Besonderheit der Entwicklungen in der späteren Türkei im Vergleich zu den anderen Ländern der sogenannten muslimischen Welt besser ermessen zu können, gilt es, in einem dritten Schritt den Charakter des arabischen Nationalismus der damaligen Zeit unter dem Blickwinkel zu diskutieren, wie hier der Einfluss des Islam einzuschätzen ist. Hiernach wendet sich die Untersuchung den ideologisch-politischen Strömungen des letzten Jahrhunderts des Osmanischen Reichs zu. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert traten drei zentrale, teilweise aber nicht klar voneinander zu unterscheidende Doktrinen zur Gestaltung der Staats- und Gesellschaftsordnung hervor, die jeweils skizziert werden sollen: Osmanismus, Islamismus und Pantürkismus (Turanismus). Der spätere türkische Nationalismus hingegen unterschied sich klar von diesen dreien. Ein letzter Abschnitt dieses Kapitels wird in groben Strichen die nationalistische Bewegung um Mustafa Kemal Atatürk nachzeichnen sowie eine zusammenfassende Skizzierung der Gründung des modernen türkischen Nationalstaats mit ihren politischen und rechtlichen Veränderungen der Staats- und Gesellschaftsordnung vornehmen.
Staat und Gesellschaft im Osmanischen Reich
Das Osmanische Reich wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts gegründet und fand eine rasche Ausdehnung seiner Herrschaftsgebiete über die arabische Halbinsel und Nordafrika. Im Jahr 1517 verlegten die Osmanen das Amt des Kalifaten nach Istanbul. Das Reich erstreckte sich zu dieser Zeit über drei Kontinente.
Die Gesellschaft im Osmanischen Reich war eine Agrargesellschaft, in der Grund und Boden das Hauptproduktionsmittel bildeten und die Machtausübung und Herrschaftssicherung auf einem spezifischen Grundherrschaftsverhältnis basierten: Der Sultan verfügte über ein weitgehendes Eigentumsmonopol und er repräsentierte als der ideelle Gesamteigentümer von Grund und Boden die Einheit des Staats, "während die reale Verfügungsgewalt über Grund und Boden sich im Nutzungsrecht" (Ahlers 1984: 28) der bäuerlichen Produzenten realisierte, die reaya genannt wurden.
In seiner außenpolitischen Expansionspolitik nach dem Prinzip von tributaneignender Unterwerfung und Eroberung ist das Osmanische Reich weitestgehend der ursprünglichen nomadischen Territorialmentalität verhaftet geblieben: "Einziehung von Steuern, Kontrolle der Handelswege, Aushebung von Rekruten, Deportation von Handwerkern" (Anderson, P. 1978: 271) waren die zentralen administrativen Eingriffe des osmanischen Staats. Diese nomadisch geprägte Eroberungsmentalität trieb den osmanischen Staat langfristig in eine systemimmanente Expansionsfalle. Das Heer wurde eingesetzt, um fremdes Territorium zu erobern oder zumindest in Tributabhängigkeit zu zwingen. Aus den eroberten Gebieten wurden Mehrprodukt und Prestigegüter abgezogen, wobei aber immer mehr Mehrprodukt für den Unterhalt des Heeres erforderlich wurde, da das Heer für die Kontrolle des wachsenden Herrschaftsgebiets und die neuen Kriegszüge stets vergrößert werden musste. Daraus entstand die ökonomische Dynamik der Expansionspolitik, die eine immer weitere Hinausschiebung der Grenzen der Eroberung verlangte, was wiederum höhere Ausgaben erforderte. Der Sozialwissenschaftler Süleymen Seyfi Ögün bezeichnet diesen Zustand als "Eroberungsparadox" (Ögün 1991: 79). Kurt Steinhaus beschreibt die Dynamik dieses Eroberungsparadoxes sehr prägnant:
"Der Krieg nährt den Krieg - auf keinen Staat trifft dieses Wort so zu wie auf den des Sultan-Kalifen. Und nicht nur das: Hier nährte der Krieg sogar das politisch-soziale Gesamtsystem. Indem die materiellen Erträge der äußeren Expansion für die Erhaltung und die Verbesserung des territorialen status quo unentbehrlich waren, bildete die militärische Überlegenheit wiederum die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in seiner bestehenden Form" (Steinhaus 1969: 29).
Außer in der Anfangsperiode gründete sich das politische System des Osmanischen Reichs nicht auf den Zusammenhalt einer schon vorhandenen Stammesgruppierung, sondern beruhte im Gegenteil auf einer eindeutig nicht stammesgebundenen Führungsschicht, deren Angehörige einzeln aus den eroberten Gebieten rekrutiert wurden. Jährlich wurde in den unterworfenen Balkanländern eine Zwangsaushebung unter den männlichen Kindern der christlichen Familien durchgeführt. Die Kinder wurden ihren Eltern entrissen und nach Istanbul oder Anatolien geschickt, wo sie nach muslimischem Glauben erzogen und für Armeedienste oder Verwaltungsaufgaben ausgebildet wurden, als die unmittelbaren Untertanen des Sultans. Beispielsweise wurden die Janitscharen, eine wichtige militärische Eliteeinheit, solcherart rekrutiert. "Auf diese Weise konnten sowohl die ghazi-Tradition der religiösen Bekehrung und militärischen Expansion wie die altislamische Tradition der Toleranz und Eintreibung von Tributen bei den Ungläubigen miteinander versöhnt werden" (Anderson, P., 1978: 475). Weitere Rekrutierungen betrafen auch die anderen Bevölkerungsgruppen. Im Osmanischen Reich schuf man somit künstlich eine Führungsschicht, die hinsichtlich ihres ethnisch-kulturellen Ursprungs heterogen zusammengesetzt war, eigentlich aus "Sklaven" bestand und politisch wie kulturell nahezu von jeglichen gesellschaftlichen Einheiten abgeschnitten war. Die Mitglieder dieser Schicht nannten sich Osmanl? und dienten dem Obrigkeitsstaat nach einer systematischen Schulung für Verwaltungsaufgaben und Kriege. Gellner schreibt zum Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten: "Während eine moderne Gesellschaft nur funktioniert, wenn zwischen Herrschenden und Beherrschten eine kulturelle Gleichartigkeit zu bestehen scheint, ist es für einen traditionellen Staat im Gegenteil von Vorteil, wenn den Herrschenden eine kulturelle Eigenart zukommt" (Gellner 1992: 171).
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Obwohl die Nation ein Ergebnis historisch relativ neuer gesellschaftlicher Entwicklungen darstellt, besitzt dieses Konzept den Schein natürlicher Gegebenheit und eine hohe emotionale Attraktivität. Am Beispiel der Türkei beleuchtet der Autor die soziologischen und psychoanalytischen Aspekte von Nationalisierungsprozessen. Nationale Muster der Selbst- und Fremdwahrnehmung spielen dabei ebenso eine Rolle wie emotional stark aufgeladene sprachliche und visuelle Symbole.
Inhaltsverzeichnis:
Danksagung
Einleitung
Teil 1: Zur Kritik des Nationalismus
1.1 Nationsverständnis
1.1.1 Nationsverständnis in traditionellen Nationalismustheorien
1.1.2 Nationsverständnis in modernen Nationalismustheorien
1.1.3 Exkurs: Nation als intermediäre Institution
1.2 Symbol und nationale Vergesellschaftung
1.2.1 Zur Versprachlichung des Sakralen
1.2.2 Zur Wirkungskraft der Verbildlichung
Teil 2: Nationalisierung der Gesellschaft in der Türkei
2.1 Vom Reich zum Nationalstaat
2.2 Schrift und Sprache der Nation
2.3 Sprache und religiöser Kult
2.4 Bilder der Nation
2.4.1 Architektur und Städtebau
2.4.2 Kleidung
2.4.3 Musik und Tanz
Schlussbetrachtung
Literatur
Leseprobe:
Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Einblick in die gesellschaftlichen Strukturen des Osmanischen Reichs bis zur Ausrufung der Türkischen Republik. Es werden in groben Zügen der Niedergang des Reichs und die Staatsgründung der Türkischen Republik mit ihren ersten staatsrechtlichen Umstrukturierungen skizziert. Dies dient dem Ziel, den im 19. Jahrhundert ansetzenden gesellschaftlichen Wandel darzustellen, um die Frage nach den subjektiven Konstitutionsbedingungen des Nationalismus in der Türkei in einen Gesamtzusammenhang einordnen zu können.
In einem ersten Schritt werden einige Aspekte der Sozialstruktur und Staatsordnung des Osmanischen Reichs umrissen. Im zweiten Schritt folgt eine Zusammenfassung der ersten Reformversuche, die das Herrscherhaus im 19. Jahrhundert zur Rettung des zerfallenden Reichs eingeleitet hat: die Tanzimat. Um die Besonderheit der Entwicklungen in der späteren Türkei im Vergleich zu den anderen Ländern der sogenannten muslimischen Welt besser ermessen zu können, gilt es, in einem dritten Schritt den Charakter des arabischen Nationalismus der damaligen Zeit unter dem Blickwinkel zu diskutieren, wie hier der Einfluss des Islam einzuschätzen ist. Hiernach wendet sich die Untersuchung den ideologisch-politischen Strömungen des letzten Jahrhunderts des Osmanischen Reichs zu. Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert traten drei zentrale, teilweise aber nicht klar voneinander zu unterscheidende Doktrinen zur Gestaltung der Staats- und Gesellschaftsordnung hervor, die jeweils skizziert werden sollen: Osmanismus, Islamismus und Pantürkismus (Turanismus). Der spätere türkische Nationalismus hingegen unterschied sich klar von diesen dreien. Ein letzter Abschnitt dieses Kapitels wird in groben Strichen die nationalistische Bewegung um Mustafa Kemal Atatürk nachzeichnen sowie eine zusammenfassende Skizzierung der Gründung des modernen türkischen Nationalstaats mit ihren politischen und rechtlichen Veränderungen der Staats- und Gesellschaftsordnung vornehmen.
Staat und Gesellschaft im Osmanischen Reich
Das Osmanische Reich wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts gegründet und fand eine rasche Ausdehnung seiner Herrschaftsgebiete über die arabische Halbinsel und Nordafrika. Im Jahr 1517 verlegten die Osmanen das Amt des Kalifaten nach Istanbul. Das Reich erstreckte sich zu dieser Zeit über drei Kontinente.
Die Gesellschaft im Osmanischen Reich war eine Agrargesellschaft, in der Grund und Boden das Hauptproduktionsmittel bildeten und die Machtausübung und Herrschaftssicherung auf einem spezifischen Grundherrschaftsverhältnis basierten: Der Sultan verfügte über ein weitgehendes Eigentumsmonopol und er repräsentierte als der ideelle Gesamteigentümer von Grund und Boden die Einheit des Staats, "während die reale Verfügungsgewalt über Grund und Boden sich im Nutzungsrecht" (Ahlers 1984: 28) der bäuerlichen Produzenten realisierte, die reaya genannt wurden.
In seiner außenpolitischen Expansionspolitik nach dem Prinzip von tributaneignender Unterwerfung und Eroberung ist das Osmanische Reich weitestgehend der ursprünglichen nomadischen Territorialmentalität verhaftet geblieben: "Einziehung von Steuern, Kontrolle der Handelswege, Aushebung von Rekruten, Deportation von Handwerkern" (Anderson, P. 1978: 271) waren die zentralen administrativen Eingriffe des osmanischen Staats. Diese nomadisch geprägte Eroberungsmentalität trieb den osmanischen Staat langfristig in eine systemimmanente Expansionsfalle. Das Heer wurde eingesetzt, um fremdes Territorium zu erobern oder zumindest in Tributabhängigkeit zu zwingen. Aus den eroberten Gebieten wurden Mehrprodukt und Prestigegüter abgezogen, wobei aber immer mehr Mehrprodukt für den Unterhalt des Heeres erforderlich wurde, da das Heer für die Kontrolle des wachsenden Herrschaftsgebiets und die neuen Kriegszüge stets vergrößert werden musste. Daraus entstand die ökonomische Dynamik der Expansionspolitik, die eine immer weitere Hinausschiebung der Grenzen der Eroberung verlangte, was wiederum höhere Ausgaben erforderte. Der Sozialwissenschaftler Süleymen Seyfi Ögün bezeichnet diesen Zustand als "Eroberungsparadox" (Ögün 1991: 79). Kurt Steinhaus beschreibt die Dynamik dieses Eroberungsparadoxes sehr prägnant:
"Der Krieg nährt den Krieg - auf keinen Staat trifft dieses Wort so zu wie auf den des Sultan-Kalifen. Und nicht nur das: Hier nährte der Krieg sogar das politisch-soziale Gesamtsystem. Indem die materiellen Erträge der äußeren Expansion für die Erhaltung und die Verbesserung des territorialen status quo unentbehrlich waren, bildete die militärische Überlegenheit wiederum die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in seiner bestehenden Form" (Steinhaus 1969: 29).
Außer in der Anfangsperiode gründete sich das politische System des Osmanischen Reichs nicht auf den Zusammenhalt einer schon vorhandenen Stammesgruppierung, sondern beruhte im Gegenteil auf einer eindeutig nicht stammesgebundenen Führungsschicht, deren Angehörige einzeln aus den eroberten Gebieten rekrutiert wurden. Jährlich wurde in den unterworfenen Balkanländern eine Zwangsaushebung unter den männlichen Kindern der christlichen Familien durchgeführt. Die Kinder wurden ihren Eltern entrissen und nach Istanbul oder Anatolien geschickt, wo sie nach muslimischem Glauben erzogen und für Armeedienste oder Verwaltungsaufgaben ausgebildet wurden, als die unmittelbaren Untertanen des Sultans. Beispielsweise wurden die Janitscharen, eine wichtige militärische Eliteeinheit, solcherart rekrutiert. "Auf diese Weise konnten sowohl die ghazi-Tradition der religiösen Bekehrung und militärischen Expansion wie die altislamische Tradition der Toleranz und Eintreibung von Tributen bei den Ungläubigen miteinander versöhnt werden" (Anderson, P., 1978: 475). Weitere Rekrutierungen betrafen auch die anderen Bevölkerungsgruppen. Im Osmanischen Reich schuf man somit künstlich eine Führungsschicht, die hinsichtlich ihres ethnisch-kulturellen Ursprungs heterogen zusammengesetzt war, eigentlich aus "Sklaven" bestand und politisch wie kulturell nahezu von jeglichen gesellschaftlichen Einheiten abgeschnitten war. Die Mitglieder dieser Schicht nannten sich Osmanl? und dienten dem Obrigkeitsstaat nach einer systematischen Schulung für Verwaltungsaufgaben und Kriege. Gellner schreibt zum Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten: "Während eine moderne Gesellschaft nur funktioniert, wenn zwischen Herrschenden und Beherrschten eine kulturelle Gleichartigkeit zu bestehen scheint, ist es für einen traditionellen Staat im Gegenteil von Vorteil, wenn den Herrschenden eine kulturelle Eigenart zukommt" (Gellner 1992: 171).
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.