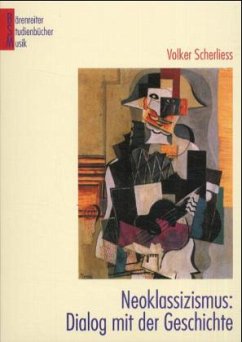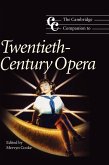In unserer "postmodernen" Zeit sind wir gewohnt, mit der Geschichte spielerisch umzugehen: In unserer "postmodernen" Zeit sind wir gewohnt, mit der Geschichte spielerisch umzugehen: Historische Stile und konkrete Werke stehen uns heute wie Kostüme und Masken im Fundus eines Theaters jederzeit zur Verfügung. Sie bilden einen unerschöpflichen Vorrat und dienen als Anregungsquelle für immer neue Verkleidungen - in der Musik ebenso wie in der Literatur, in den bildenden Künsten und ganz besonders in der Architektur. Um einen Dialog mit der Geschichte geht es auch in diesem Buch aus der Reihe "Bärenreiter Studienbücher Musik", in dessen Mittelpunkt neoklassizistische Tendenzen der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts stehen. Wenn man von "Neoklassizismus" spricht, ist generell der Rückgriff des 20. Jahrhunderts auf historische Vorbilder gemeint. Volker Scherliess benutzt das Wort aber in einem übergreifenden Sinn: Nicht eingeschränkt auf den einheitlichen Stil der sogenannten "Neoklassizisten" um Strawinsky, sondern im Sinne einer künstlerischen Grundhaltung, die auch die Komponisten der Wiener Schule um Schönberg teilten, ja selbst ein Spätromantiker wie Richard Strauss. Der Horizont des Themas (und des Lesers) wird durch Einbeziehung neoklassizistischer Tendenzen in den Nachbarkünsten Malerei, Tanz, Literatur und bildende Kunst erweitert, ebenso durch Bemerkungen zur "historischen Aufführungspraxis", zur Entdeckung des Mittelalters oder zum Themengebiet "Musik und Politik". Zahlreiche Bilder, Notenbeispiele, Aufgaben zum Weiterdenken und Stichworte zur Zeitgeschichte machen das Buch zu einer ungewöhnlichen und anregenden Studienhilfe.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Volker Scherliess klaut dem Klassizismus alle klassische Klarheit
Seltsam: Da wird ein breites musikgeschichtliches Wissen entfaltet, in einer flüssigen und untechnischen Sprache, angereichert mit Querverweisen auf die Nachbarkünste, mit Seitenblicken auf den politischen Kontext, mit Abbildungen, Notenbeispielen, nützlichen Literaturhinweisen, "Anregungen zum Weiterdenken" - und trotzdem weiß man bis zum Schluß nicht genau, worum es geht. Der Hauptvorzug des von Volker Scherliess verfaßten Studienbuches über den musikalischen "Neoklassizismus" ist zugleich sein größter Nachteil. Seine Ausführungen fallen so bunt und detailliert aus, weil er sich scheut, ihren Gegenstand zu bestimmen.
Der Autor reagiert damit freilich auf eine im Thema selbst liegende Schwierigkeit. Denn tatsächlich ist die Rede von einem "Neoklassizismus" im Bereich der Musik ebenso vage wie prekär. Grob versteht man darunter eine kompositorische Strömung in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, in der die Mobilisierung neuer konstruktiver Kräfte zur idiomatischen Orientierung an historischen Vorbildern führte. Die Erweiterung des harmonischen Ausdrucks mit ihrer Tendenz zur Verselbständigung seiner Farbvaleurs - exemplarisch etwa bei Wagner und Debussy - hatte das Komponieren allmählich in eine Krise gebracht, die spätestens nach dem Ersten Weltkrieg offen zutage trat. Um größere Zusammenhänge formen zu können, brauchte man nun ein bindendes Gegenlager zu den gestaltauflösenden expressiven Gesten. Versuche, aus dem musikalischen Material neue konstruktive Funken zu schlagen, führten zu unterschiedlichen Lösungen, deren Parteigänger sich bald in polemische Auseinandersetzungen verstrickten. Als vermeintliche Antipoden spielte man Strawinsky und Schönberg gegeneinander aus. Dem Begründer der Zwölftonmethode wurde eine Art zersetzende Hyper-Romantik vorgeworfen, dem Komponisten von "Pulcinella" oder "Oedipus rex" eine versatzstückhafte Pseudo-Modernität.
"Neoklassizismus" wurde zum Schlagwort für eine antiromantisch gesinnte Rückkehr zur klaren Ordnung alter Formen. Dabei haben die so etikettierten Werke mit einer künstlerisch unselbständigen Zuflucht zur Autorität veralteter Normen tatsächlich nichts gemein. Vom pejorativen Beigeschmack möchte Scherliess den Begriff des Neoklassizismus befreien. Statt jedoch zu untersuchen, wie der Rückbezug auf historische Vorlagen künstlerisch innovativ werden konnte, wählt der Autor zur Ehrenrettung eine andere Strategie. Rein deskriptiv will er den Begriff verwenden. "Kein Künstler schöpft ja allein aus sich selbst heraus", mit diesem Gemeinplatz verteidigt der Autor das "neoklassizistische" Komponieren, er stehe "immer im Dialog mit der Geschichte". Daraus schließt Scherliess zunächst, daß alles zu seinem Thema gehört. Darstellen möchte er "die Musikgeschichte der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts unter dem besonderen Aspekt, wie Komponisten ,Tradition' verstanden".
Die großzügige Terminologie erlaubt es ihm, im Musiktheater von Richard Strauss und im "Formalismus" Strawinskys, in Folklorismus und Futurismus, Jugendmusikbewegung, Wiener Schule und Neuer Sachlichkeit die gleiche kulturgeschichtliche Strömung zu entdecken. Kurzweilig berichtet er von historisierenden Tendenzen bei Brieg, Ravel, Tippett und Tschaikowsky, von Bühnen- und Stummfilmmusiken, die sich bei Mozart, Beethoven oder Gluck bedienten, und von Barockmotiven auf einem Werbeplakat. Leider drohen Schlagworte wie "Musik über Musik" oder "aus alt mach neu" die Unterschiede unsichtbar zu machen.
Die Beschreibungen einzelner Kompositionen zählen vor allem auf, welche "Ingredienzien" in ihnen "gemischt" wurden. So hatte Strawinsky einen "großen schöpferischen Appetit". An seiner Oper "The Rake's Progress", erläutert Scherliess, "läßt sich die ganze Speisekarte rekonstruieren, aus der sich Strawinsky bediente". "Dabei war Strawinsky kein Kostverächter, aber er war auch beileibe kein Allesfresser; er wählte nur aus, was seiner Musik bekömmlich war." In die Details der Anverdauung - man mag das bedauern oder begrüßen - vertieft sich der Autor jedoch nicht.
Worin sich eine "bloße Stilkopie" oder eine "dekorative Gebrauchsmusik, die gleichsam abschnurrt", von einer gelungenen Komposition unterscheidet, kann Scherliess nicht erklären. Leitmotivisch zieht sich diese Frage daher durch das ganze Buch, bis ihr sogar ein eigener Abschnitt mit dem Titel "Kunst oder ,Bastelei'?" gewidmet ist. Aber selbst hier weicht Scherliess noch aus und benügt sich mit der leeren Bekräftigung, daß diese Unterscheidung nicht klar zu bestimmen sei, obgleich man trotzdem an ihr festhalten müsse. Spätestens damit zeigt die "reine" Deskription ihr normatives Gesicht. Daß die einzigen Kriterien ästhetischer Qualität im persönlichen Geschmack des Rezipienten lägen, hatte der Autor dem Adressaten seines Studienbuchs schon in der Einleitung mit auf den Leseweg gegeben. "Und über Geschmack", so führte er aus, "läßt sich trefflich streiten (wobei, diese Bemerkung ist notwendig, über Geschmack nur streiten sollte, wer auch welchen hat . . .)."
Seinen Gegenstand, den er gar nicht fassen möchte, überwältigt der Autor schließlich mit einer Bestimmung ex negativo. Neoklassizismus sei antiromantisch, lehne den Ausdruck ab, sei nicht organisch und negiere den Sprachcharakter der Musik. Am Ende verhärtet sich der Begriff Neoklassizismus also doch wieder zum Kampfwort. Das Kapitel "Formalismus - Kunst-Recycling, oder: Arbeit mit vorgefundenem Material" erklärt das neunzehnte Jahrhundert zum Mülleimer: "Der Schutt einer verbrauchten Tradition muß weggeräumt werden, aber aus den alten Materialien läßt sich noch etliches herstellen." Nicht nur Musikstücke, sondern auch Bücher wie dieses.
JULIA SPINOLA
Volker Scherliess: "Neoklassizismus". Dialog mit der Geschichte. Bärenreiter Studienbücher Musik, Band 8. Bärenreiter Verlag, Kassel 1998. 400 S., Abb., br., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Die Breite des Ansatzes von Scherliess, der die Antikenrezeption, die Neubewertung des Mittelalters, aber auch Ansätze zur historischen Aufführungspraxis neben die Wiederentdeckung und Fruchtbarmachung der Barockmusik stellt, ist neben der Übersichtlichkeit und didaktischen Klarheit besonders hervorzuheben." (Pforzheimer Zeitung 3.6.1998)