Nicht lieferbar
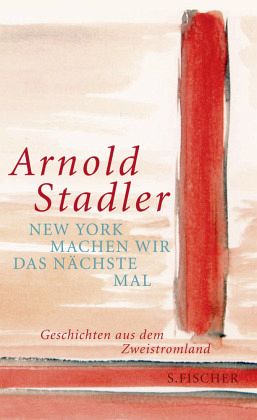
New York machen wir das nächste Mal
Geschichten aus dem Zweistromland
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
"Kaum hat der Mensch seinen Schreibtisch aufgeräumt, so glaubt er schon, es sei Ordnung möglich", sagt Arnold Stadler, aber "Ordnung ist wohl nur eine Charakterfrage und beweist gar nichts." Das Unaufgeräumte ist das Ordnungsprinzip von Stadlers Literatur. In 'New York machen wir das nächste Mal' erzählt er traurige und verträumte Geschichten: Es gibt ein unverhofftes Wiedersehen mit den alten Bekannten aus Stadlers großen Romanen, den schmerzhaft Verliebten und mit großer Geste Schüchternen. Es sind die, die ankommen und trotzdem nicht bleiben, die abreisen, um zu leben, die Ordnungs...
"Kaum hat der Mensch seinen Schreibtisch aufgeräumt, so glaubt er schon, es sei Ordnung möglich", sagt Arnold Stadler, aber "Ordnung ist wohl nur eine Charakterfrage und beweist gar nichts." Das Unaufgeräumte ist das Ordnungsprinzip von Stadlers Literatur. In 'New York machen wir das nächste Mal' erzählt er traurige und verträumte Geschichten: Es gibt ein unverhofftes Wiedersehen mit den alten Bekannten aus Stadlers großen Romanen, den schmerzhaft Verliebten und mit großer Geste Schüchternen. Es sind die, die ankommen und trotzdem nicht bleiben, die abreisen, um zu leben, die Ordnungs- und Glückssucher, die sich in diesen Denkbildern und Episoden wiedertreffen und so einen Empfang bereiten für ein weiteres Kapitel des einen, großen Werkes, an dem Arnold Stadler unermüdlich schreibt.









