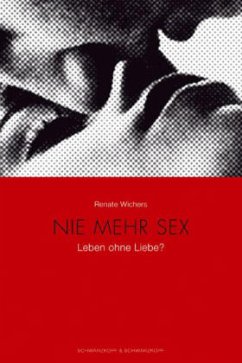»Kann es sein, dass in einer Gesellschaft, in der so viel über Sex geschrieben und geredet wird, die Realität ganz anders aussieht?« Wie lebt es sich ohne Sexualität, wie sehr beeinträchtigt sie das Leben, wie sehr vermissen Menschen Sexualität? Kann man auch ein erfülltes und glückliches Leben ohne Sex führen, und ist Sexualität in unserer Zeit nicht gänzlich überbewertet? Diesen Fragen geht die Autorin nach, indem sie möglichst verschiedene Frauen und Männer unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Lebenssituationen zu dem Thema befragt, warum sie keinen Sex haben, wie lange schon nicht mehr oder warum sie vielleicht sogar noch nie welchen hatten.
»Heute ist kaum etwas so peinlich wie zuzugeben, dass man keinen Sex hat. Wer Erfolg hat, hat auch Sex. Sexuell attraktiv zu sein, gefragt zu sein, hat oft etwas mit dem Stellenwert zu tun, den man innerhalb einer Gesellschaft einnimmt. Doch kann es sein, dass in einer Gesellschaft, in der so viel über Sex geschrieben und geredet wird, die Realität ganz anders aussieht?«Renate Wichers
»Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.« Die 60er Jahre waren die sog. Zeit der sexuellen Befreiung, die in einem politisch links orientierten Milieu ihren Anfang nahm. Die Popmusik dieser Zeit spiegelte das ebenfalls wider. »All we need is love«. Sexualität hatte jetzt nicht mehr nur im legalisierten Rahmen der Ehe ihren Platz, Sexualität wurde als ein natürliches Bedürfnis des Menschen gesehen, das genauso besteht wie Essen und Trinken. Die unterdrückte Sexualität wurde als einer der Gründe angeführt, die Menschen veranlassen, Kriege zu führen. »Make love! Not war!« Es schien so, als wären mit der »sexuellen Revolution« alle Probleme der Menschheit gelöst. Wir wissen, dass das eine naive und unzureichende Erklärung des menschlichen Wesens ist. Heute ist kaum etwas so peinlich wie zuzugeben, dass man keinen Sex hat. Wer Erfolg hat, hat auch Sex. Sexuell attraktiv zu sein, gefragt zu sein, hat oft etwas mit dem Stellenwert zu tun, den man innerhalb einer Gesellschaft einnimmt. Man fällt aus diesem Raster, wenn man äußerlich benachteiligt ist, sei es, dass man zu dünn, zu dick, zu alt, behindert, krank ist oder arbeitslos. Und als Obdachloser steht man gänzlich außerhalb gesellschaftlicher Normen und Werte. Wir leben in einer vollständig sexualisierten Gesellschaft und auch in einer scheinbar tabufreien. Sex ist käuflich überall verfügbar, sei es auf dem Strich oder in Pornokinos. Aber wie sehr können wir den Statistiken trauen, den Umfragen, wie oft jemand Sex mit einem Partner hat. Werden die, die überhaupt keinen haben, wahrheitsgetreu antworten oder nicht eher die Antwort geben, von der sie glauben, dass sie »richtig« sei? Vielleicht wird nirgendwo so viel gelogen wie beim Thema Sex? Zeitungen und Illustrierte ködern ihre Leser mit Reportagen, die auf immer neue Weise Sex thematisieren. Kann es sein, dass in einer Gesellschaft, in der so viel über Sex geschrieben und geredet wird, die Realität ganz anders aussieht? Was ist, wenn Sex in der Öffentlichkeit in einer Weise dargestellt wird, in der sich die Wirklichkeit nur sehr partiell spiegelt, und »die im Dunklen, die sieht man nicht«? Und wie sieht es mit Cybersex aus? Wer praktiziert Cybersex? Scheitern Menschen daran, ihre Phantasien in die Wirklichkeit umzusetzen, vielleicht wegen ihrem Unvermögen sich mit Menschen aus Fleisch und Blut einzulassen oder aufgrund ihrer zu hohen Erwartungen? Inwiefern hat AIDS Einfluss auf das sexuelle Verhalten der Menschen genommen, bewusst oder auch unbewusst? Und inwiefern spielen gewisse Antisex-Trends, wie sie angeblich in den USA anzutreffen sind, eine Rolle? Im »Kamasutra«, das Vatsyayana im 3. oder 4. Jahrhundert verfasst hat, steht im Kapitel »Ziel des Lebens«: »Der Mensch ist von seiner Sexualität abhängig. Die Frage ist, wo fängt Sexualität an, und wo hört sie auf. Bedeutet, keinen Sex zu haben, keinen Partner zu haben, mit dem man sie praktiziert, oder heißt das, dass man seine Sexualität so sublimiert hat, dass man sie als solche gar nicht mehr empfindet oder spürt?« Wie lebt es sich ohne Sexualität, wie sehr beeinträchtigt sie das Leben, wie sehr vermissen Menschen Sexualität? Kann man auch ein erfülltes und glückliches Leben ohne Sex führen, und ist Sexualität in unserer Zeit nicht gänzlich überbewertet? Diesen Fragen geht die Autorin nach, indem sie möglichst verschiedene Frauen und Männer unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Lebenssituationen zu dem Thema befragt, warum sie keinen Sex haben, wie lange schon nicht mehr oder warum sie vielleicht sogar noch nie welchen hatten.
»Heute ist kaum etwas so peinlich wie zuzugeben, dass man keinen Sex hat. Wer Erfolg hat, hat auch Sex. Sexuell attraktiv zu sein, gefragt zu sein, hat oft etwas mit dem Stellenwert zu tun, den man innerhalb einer Gesellschaft einnimmt. Doch kann es sein, dass in einer Gesellschaft, in der so viel über Sex geschrieben und geredet wird, die Realität ganz anders aussieht?«Renate Wichers
»Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.« Die 60er Jahre waren die sog. Zeit der sexuellen Befreiung, die in einem politisch links orientierten Milieu ihren Anfang nahm. Die Popmusik dieser Zeit spiegelte das ebenfalls wider. »All we need is love«. Sexualität hatte jetzt nicht mehr nur im legalisierten Rahmen der Ehe ihren Platz, Sexualität wurde als ein natürliches Bedürfnis des Menschen gesehen, das genauso besteht wie Essen und Trinken. Die unterdrückte Sexualität wurde als einer der Gründe angeführt, die Menschen veranlassen, Kriege zu führen. »Make love! Not war!« Es schien so, als wären mit der »sexuellen Revolution« alle Probleme der Menschheit gelöst. Wir wissen, dass das eine naive und unzureichende Erklärung des menschlichen Wesens ist. Heute ist kaum etwas so peinlich wie zuzugeben, dass man keinen Sex hat. Wer Erfolg hat, hat auch Sex. Sexuell attraktiv zu sein, gefragt zu sein, hat oft etwas mit dem Stellenwert zu tun, den man innerhalb einer Gesellschaft einnimmt. Man fällt aus diesem Raster, wenn man äußerlich benachteiligt ist, sei es, dass man zu dünn, zu dick, zu alt, behindert, krank ist oder arbeitslos. Und als Obdachloser steht man gänzlich außerhalb gesellschaftlicher Normen und Werte. Wir leben in einer vollständig sexualisierten Gesellschaft und auch in einer scheinbar tabufreien. Sex ist käuflich überall verfügbar, sei es auf dem Strich oder in Pornokinos. Aber wie sehr können wir den Statistiken trauen, den Umfragen, wie oft jemand Sex mit einem Partner hat. Werden die, die überhaupt keinen haben, wahrheitsgetreu antworten oder nicht eher die Antwort geben, von der sie glauben, dass sie »richtig« sei? Vielleicht wird nirgendwo so viel gelogen wie beim Thema Sex? Zeitungen und Illustrierte ködern ihre Leser mit Reportagen, die auf immer neue Weise Sex thematisieren. Kann es sein, dass in einer Gesellschaft, in der so viel über Sex geschrieben und geredet wird, die Realität ganz anders aussieht? Was ist, wenn Sex in der Öffentlichkeit in einer Weise dargestellt wird, in der sich die Wirklichkeit nur sehr partiell spiegelt, und »die im Dunklen, die sieht man nicht«? Und wie sieht es mit Cybersex aus? Wer praktiziert Cybersex? Scheitern Menschen daran, ihre Phantasien in die Wirklichkeit umzusetzen, vielleicht wegen ihrem Unvermögen sich mit Menschen aus Fleisch und Blut einzulassen oder aufgrund ihrer zu hohen Erwartungen? Inwiefern hat AIDS Einfluss auf das sexuelle Verhalten der Menschen genommen, bewusst oder auch unbewusst? Und inwiefern spielen gewisse Antisex-Trends, wie sie angeblich in den USA anzutreffen sind, eine Rolle? Im »Kamasutra«, das Vatsyayana im 3. oder 4. Jahrhundert verfasst hat, steht im Kapitel »Ziel des Lebens«: »Der Mensch ist von seiner Sexualität abhängig. Die Frage ist, wo fängt Sexualität an, und wo hört sie auf. Bedeutet, keinen Sex zu haben, keinen Partner zu haben, mit dem man sie praktiziert, oder heißt das, dass man seine Sexualität so sublimiert hat, dass man sie als solche gar nicht mehr empfindet oder spürt?« Wie lebt es sich ohne Sexualität, wie sehr beeinträchtigt sie das Leben, wie sehr vermissen Menschen Sexualität? Kann man auch ein erfülltes und glückliches Leben ohne Sex führen, und ist Sexualität in unserer Zeit nicht gänzlich überbewertet? Diesen Fragen geht die Autorin nach, indem sie möglichst verschiedene Frauen und Männer unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Lebenssituationen zu dem Thema befragt, warum sie keinen Sex haben, wie lange schon nicht mehr oder warum sie vielleicht sogar noch nie welchen hatten.