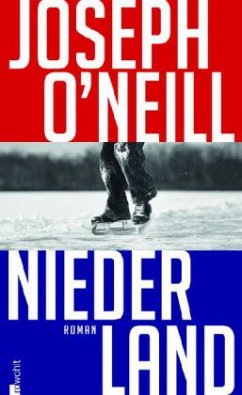Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Als "ebenso zeitgenössisch wie poetisch" feiert Rezensent Ijoma Mangold diesen Roman, der in der Welt nach dem 11. September in einer "postnationalen Weltgesellschaft" spielt und Mangold zufolge von den Herausforderungen erzählt, "Halt zu finden in einer Welt, die immer in Bewegung ist". Joseph O?Neill bringe zwei unterschiedliche Milieus zusammen, die jeweils auf ihre eigene Weise frei von ihrer Herkunft den Strömen des Geldes und der Wohlstandsverteilung folgten: Broker und Migranten. Besonders der "tiefsinnige und vielschichtige" Protagonist - ein holländischer Analyst in New York, dessen Ehe nach den Anschlägen zerbricht - hat es dem Rezensenten angetan, der nach dem Scheitern seiner Ehe Bekanntschaft mit einem Cricketfanatiker aus Trinidad schließt. Dieser Chuck hält, wie man liest, den Sport der britischen Upperclass für ideal, um den Clash of Civilisations zu entschärfen. Und in der Zusammenführung der beiden Milieus vermesse dieser Autor geschickt zwei Perspektiven auf Postkolonialismus und Globalisierung. Wer außerdem die "manisch-depressive Stimmung" der Jahre nach dem 11. September verstehen wolle, dem legt Mangold diesen klugen und eindringlichen Roman ebenfalls sehr ans Herz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Joseph O'Neills "Niederland" ist einer der meistbeachteten Romane dieses Frühjahrs. Er spielt im Chelsea Hotel, wo auch der Autor mit seiner Familie lebt.
NEW YORK, im März
Ein junger Mann mit Pudelmütze sitzt vor einem Fenster auf der Heizung und blickt auf die 23. Straße. Vor der Holzbank, die unter einem Gemälde von Philip Taaffe steht, wartet eine korpulente Frau mit Koffer und beobachtet einen Touristen, der die in der Lobby des Chelsea Hotel ausgestellten Kunstwerke fotografiert. Pfeifen der alten Heizkörper, Straßenlärm. Die phantasmagorische, irgendwie diffuse Welt jenseits der schweren Glastür. Larry Rivers' Assemblage "Dutch Masters", daneben ein Aquarell von David Remfry. Zwei Frauen, die sich am Empfang unterhalten, während aus dem Aufzug ein anderer Mann mit Pudelmütze tritt und sich mit seinem Laptop in einen der Sessel setzt.
"Das Hin und Her von Menschen in der Lobby hatte etwas Anästhesierendes", so Hans van den Broek, der Erzähler von "Niederland", Joseph O'Neills gerade in Deutschland erschienenem Roman (F.A.Z. vom 7. März). Hans hat Frau und Sohn gerade nach England begleitet, wo sich die beiden sicherer fühlen als in New York. Nach seiner Rückkehr hat er das verstörende Gefühl, dass in diesen ersten Monaten seit den Terroranschlägen des 11. September nicht nur über der Stadt, sondern auch über seiner Ehe "die letzte Dämmerung" angebrochen ist. Hans arbeitet als Equities-Analyst einer Handelsbank, doch der berufliche Erfolg hilft ihm nicht über das Elend hinweg, in das ihn die Trennung von seiner Familie stürzt. Wenn er sich abends in der Lobby des Chelsea in einen Sessel fallen lässt, ist er auf der Suche nach Mitleid und Trost.
Als O'Neill mit seinen drei Söhnen das Chelsea betritt, die Lobby durchquert und die Kinder vor sich in den Fahrstuhl schiebt, ist New York in ein mildes urbanes Abendlicht getaucht. "Ein Hotel ist natürlich ein Ort des Übergangs, des Flüchtigen und Instabilen", sagt O'Neill, dessen Roman nicht nur den Zeitgeist des von der Katastrophe verdunkelten Augenblicks bewahrt, sondern auch dem Hotel ein Denkmal setzt, das der Schriftsteller zum Ausgangspunkt der Erkundungen macht, die sein in den Grundfesten erschütterter Erzähler unternimmt. "Aber für Hans, den die Mannigfaltigkeit der Bewohner an das Aquarium erinnert, das er als Kind besessen hatte, wird das Chelsea paradoxerweise zu einem Ort der Stabilität."
Mark Twain und O. Henry haben hier gewohnt, in Zimmer 831 des 1883 erbauten Appartementhauses, in dem 1905 das Chelsea Hotel eröffnete, arbeitete Thomas Wolfe an seinen letzten Romanen. Düstere, mit den Bildern ehemaliger oder jetziger Gäste behängte Flure; die Treppe, die "kraft der tiefen, rechteckigen Leere in ihrer Mitte den Effekt hatte", wie es in "Niederland" heißt, "im Herzen des Gebäudes einen Abgrund zu schaffen". Burroughs' "Naked Lunch" und Kerouacs "On the Road" sind der Legende nach hier entstanden, Arthur C. Clarke schrieb im Chelsea, das bis heute vor allem von Langzeitmietern bewohnt wird, seine Weltraumodyssee "2001". Bob Dylan und Leonard Cohen, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Patti Smith und Madonna: die Liste der Künstler, die dem Hotel zu seinem berühmten Namen verhalfen, erzählen amerikanische Kulturgeschichte.
Durch die unteren Etagen zieht der säuerliche Geruch ungemachter Betten. "Die Vergangenheit und die Tradition des Hotels interessieren mich allerdings nur wenig", sagt O'Neill, der seit 1998 dort wohnt. "Was mich fasziniert, ist die sehr reale Existenz der Menschen, die hier heute leben, die Gemeinschaft und Freundschaft mit Leuten, von denen die meisten ganz ähnliche Prioritäten haben wie ich." Da ist die etwa achtzigjährige Person unbestimmbaren Geschlechts, die einen Revolver trägt und "jedem, der auf unserer Etage Ärger mache", Zunder geben werde. Da ist der mit einem Engelskostüm bekleidete Mann, der eines Tages auf der Suche nach seiner entlaufenen Katze vor Hans' Appartement steht, "die Familie mit drei kleinen Jungen", wie es in "Niederland" heißt, "die mit Dreirädern, Bällen und Bobbycars durch die Flure tobten". Ein Ball springt gegen die Wand, einer der beiden Jungen, die vor der offenen Tür spielen, läuft ihm hinterher und schießt ihn zu seinem jüngeren Bruder zurück. "Warten Sie einen Augenblick, ich bin in der Küche", ruft Joseph O'Neill auf den Flur hinaus. Er kommt an die Tür, ein Handtuch in der Hand: "Sie sind nicht der Mann vom Pizzadienst."
Joseph O'Neill ist 44 Jahre alt. Er ist der Autor der Romane "This is the Life" und "The Breezes", von "Blood-Dark Track", der im Jahr 2000 erschienenen Familiengeschichte über seine in den Zeitläuften verstrickten Großväter. Sieben Jahre schrieb er an "Niederland". O'Neill ist nicht sehr groß, er hat die sportliche, etwas aggressive Präsenz eines Athleten. Er trägt offene Turnschuhe; im Gang neben der Tür des Appartements, das er mit seiner Frau, der "Vogue"-Redakteurin Sally Singer, und den drei Kindern bewohnt, liegen mehrere Skateboards. "Meine Söhne sind alle hier im Chelsea aufgewachsen", erzählt O'Neill, "das Hotel ist unser Zuhause. Aber wenn ich in Detroit leben würde, hätte ich den Roman vermutlich dort spielen lassen. Ich schreibe realistische Romane und mache mir bei der Arbeit die Umstände zunutze, mit denen ich vertraut bin. Sie helfen mir, das Bild auszufüllen."
"Niederland" ist einer der schönsten New-York-Romane der letzten Jahre, ein elegischer, vom kontrollierten Pathos seiner stillen, lyrischen Sprache berauschter Monolog, in dem der aus Den Haag stammende Hans van den Broek von der Begegnung mit dem verschlagenen Geschäftsmann Chuck Ramkissoon erzählt, der Hans in seinen Traum von der Errichtung eines Cricketstadions einspinnt. "Niederland" erzählt die von Erinnerungen an Fitzgeralds "Großen Gatsby" belebte Geschichte eines American Dreamers, doch das Buch ist nicht der neue "große amerikanische Roman" (F.A.Z. vom 7. März). "Die Vorstellung, dass ein Roman Teil einer nationalen Literatur sei, geht auf das neunzehnte Jahrhundert zurück", sagt O'Neill, "aber die Welt, in der wir heute leben, definiert sich zunehmend nicht mehr über nationale Grenzen."
O'Neill hat einen irischen Vaters und eine türkische Mutter: In "Dark-Blood Track" - der eine Großvater war aktives Mitglied der IRA, der andere ein weltläufiger, 1942 unter Spionageverdacht verhafteter Hotelier aus Mersin - erwähnt er die Migration seiner Familie nach Südafrika, Moçambique und Syrien, von der Türkei nach Iran, bevor sie sich 1970 in Den Haag niederließ, wo der 1964 in Cork geborene O'Neill größtenteils aufwuchs. "Ich habe neben meinem irischen inzwischen zwar auch einen amerikanischen Pass", sagt O'Neill, der nach seinem Jurastudium in Cambridge mehrere Jahre als Wirtschaftsanwalt in London lebte. "Aber ich glaube, dass unsere globalisierte Welt zunehmend eine Art postnationale Kultur hervorbringt. Den Protagonisten von ,Niederland' sehe ich als Teil dieser Kultur."
"Kann ich noch etwas mehr Knoblauch haben?" O'Neill packt Pizza aus, er greift zum Telefon und bittet den Mann am Empfang, den ältesten Sohn zum Essen hochzuschicken. Aus einem der anderen Zimmer kommt eine Katze angelaufen. "Meine angeborene Begabung ist vermutlich eher das Komische", sagt O'Neill, "und wenn ich gezwungen wäre, einen Roman in einem halben Jahr zu schreiben, käme sicherlich etwas Humoristisches dabei heraus." Auch die beiden Romane, die er in seinen Zwanzigern geschrieben habe, seien im Wesentlichen humoristische oder tragikomische Werke.
In "This is the Life", seinem 1991 erschienenen Debüt, erzählt er von einem jungen, im Phlegma erfolglos dahintreibenden Anwalt, der eines Tages den überraschenden Anruf eines bewunderten Kollegen erhält, der ihn um Hilfe bittet. "The Breezes", O'Neills 1995 veröffentlichter zweiter Roman, handelt von einer von Pech und Unglück verfolgten Familie, von dem nicht sonderlich plausibel erzählten Versuch eines Sohns, dem Sog eines blutdunklen Schicksals zu entkommen. Auch in diesen Romanen verwendet O'Neill ein erzählendes Ich: Doch anders als in seinem von einer mitunter fast existentiellen Ernsthaftigkeit erfüllten dritten Buch fehlt es den früheren Erzählerstimmen an Dringlichkeit und Autorität.
"Wenn man einmal die richtige Stimme gefunden hat", sagt O'Neill, während sein jüngster Sohn von seinem Schoß rutscht und in das Zimmer läuft, in dem das Schlagzeug steht, "hat man alle möglichen erzählerischen Freiheiten. Man will dann nur noch in Gesellschaft dieser Stimme sein und entdeckt die Bedeutung dessen, was man schreibt, gewissermaßen erst während der Arbeit daran." Es habe Jahre gebraucht, bevor er die Stadt New York, die sich mit dem 11. September und seit Beginn des Irak-Kriegs ständig veränderte, überhaupt wieder "aus einer halbwegs stabilen Perspektive" wahrnehmen konnte. Aus dem Hinterzimmer Trommeln und Geschrei. "Und während der ersten drei oder vier Jahre der Arbeit an ,Niederland' sind natürlich zwei meiner Söhne zur Welt gekommen", sagt O'Neill, "und mein Ältester war noch ein Baby, was die Arbeit ebenfalls verlangsamt hat." Er lehnt sich entspannt in den Stuhl zurück, lauscht dem Spiel seiner Kinder. Er beißt in die Pizza, die inzwischen kalt geworden ist, und sagt kauend: "Freitagabend ist Pizzazeit."
THOMAS DAVID
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main