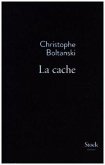Das Portrait eines Melancholikers, eines Abwesenden, eines sich und der Welt Fremden.Nach dem Tod ihres Vaters findet Gwenaëlle Aubry unter seinen Aufzeichnungen ein Manuskript mit dem Titel 'Das melancholische schwarze Schaf' und dem Vermerk 'à romancer, einen Roman daraus machen'. Sie beginnt daraufhin, ihre Erinnerungen an ihren Vater, in alphabetischer Reihenfolge von A wie Antonin Artaud bis Z wie Zelig aufzuschreiben, immer wieder erweitert um Notizen aus dem Manuskript ihres Vaters, der lange Jahre seines Lebens als manisch-depressiver Psychotiker in diversen psychiatrischen Kliniken verbracht hat.Dieser, gewissermaßen, Dialog von Vater und Tochter enthüllt nicht nur die Leidensgeschichte des Vaters, sondern zeichnet ohne jede Sentimentalität und mit großer Einfühlungskraft eine ganze, prekäre Familiengeschichte nach: der Vater, selbst Sohn eines Arztes, ist Jurist an der Universität, seine Frau trennt sich bald von ihm und zieht mit den beiden Töchtern aus, sein Lebenswegschlingert zwischen seinen Vorlesungen, seinen Freundinnen und seinen häufigen Ausbrüchen in die andere, fremde Welt. Aubry geht ihren Erinnerungen an ihre Kindheit, an die scheinheilige bürgerliche Welt der Großeltern nach und zeichnet dabei ein auch in seiner Sprache erstaunliches, berührendes Bild eines schwierigen Verhältnisses - und eines großen Verlustes: nicht nur eines verschwundenen Vaters, sondern eines abwesenden Ich, eines Ich, das sich im Lauf seiner Krankengeschichte in vielerlei Masken und personae wiederzufinden hofft.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Liebe zur Sprache, Liebe zum Vater, das sind die beiden Eckpfeiler, auf denen die Philosophin Gwenaëlle Aubry laut Niklas Bender ihren Roman in 26 Kapiteln aufbaut. Das Buch dreht sich um den Vater der Autorin, einen Juraprofessor, und seinen Kampf gegen den Wahnsinn. Für Bender ein schwieriger Gegenstand, dessen Darstellung der Autorin jedoch mittels eines strengen alphabetischen Schlagwortkatalogs und durch tastendes Vorgehen überzeugend gelingt, "mit dem Feingefühl eines Wortarztes im Noteinsatz". Das Ergebnis ist laut Bender der zu Lebzeiten weitgehend ausgebliebene intellektuelle Austausch mit dem Vater, mitunter durch Überhöhungsfantasien zwar etwas überstrapaziert, schreibt der Rezensent, doch offensichtlich befreiend.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Sich dem Schrecken mit Hilfe des Alphabets nähern: Die französische Autorin und Philosophin Gwenaëlle Aubry erzählt in "Niemand" von ihrem verdämmernden Vater.
Niemand" ist eigentlich kein Roman: In sechsundzwanzig Kapiteln berichtet Gwenaëlle Aubry vom Wahnsinn ihres Vaters François-Xavier, eines angesehenen Juraprofessors und Spezialisten für Dezentralisierung. Es ist ein diskreter, zutiefst anrührender Text über einen äußerst schwierigen Gegenstand: einen gebildeten Mann und liebenden Vater, der den inneren Abgründen immer weniger entgegensetzen kann, umherirrt Halt in aussichtslosen Beziehungen sucht, sein Erbe verschleudert und vertrinkt, von Sanatorien für Bessergestellte in die Psychiatrie wechselt und erst am Lebensende eine Art fragilen Halt findet. Drei Jahre nach seinem Tod unternimmt die französische Schriftstellerin und Philosophin Aubry nun den Versuch, diese erschütternde Erfahrung zu fassen und verwandelt sie in ein faszinierendes Stück Literatur.
Das Vorgehen ist so simpel wie elegant: Die 1971 geborene Autorin Gwenaëlle Aubry bemüht das Alphabet, um sich dem Schrecken zu nähern. Wie in einer Fibel dienen Schlagwörter in alphabetischer Reihung als eine Art "zerbrechliche, sehr hoch über der Abwesenheit hängende Brücke", die den Abgrund gerade dadurch überwindet, dass sie ihn durchquert. Eine Fibel, das scheint ein treffendes Modell, ist der Vater doch ein ewig Fünfjähriger, die Autorin sein Kind und das Alphabet eine sprachliche Elementarordnung. Die menschliche Kommunikation muss die Probe bestehen: Hält sie Chaos und Leere aus? Die Frage entspringt nicht intellektueller Muße, sondern schierer Not.
Eine befriedigende Antwort erhält der Leser nur, weil Gwenaëlle Aubry die Sprache mit äußerstem Takt handhabt - mit dem Feingefühl eines Wortarztes im Noteinsatz. Von "Antonin Artaud" bis "Zelig", mit James Bond, gisants (liegenden Figuren), Dustin Hoffman, traître (Verräter): Einträge zu Schauspielern, Motiven, Situationen, Sachthemen, ob banal oder hochkulturell, zeichnen das "Porträt aus sechsundzwanzig Winkeln mit der fehlenden Mitte". So beliebig die Stichworte zunächst wirken, sie fügen sich zu einem aussagekräftigen Bild. Auch einzeln betrachtet, ist jedes Kapitel streng komponiert: Motiv und Wort werden sorgfältig ausgelotet, der Bedeutungsraum vermessen, wie ein verheertes Gebiet nach einer Katastrophe gesichert. Die deutsche Übersetzung von Dieter Hornig wird diesem tastenden Vorgehen vollauf gerecht; man muss ihm dafür danken, dass er dem hiesigen Publikum die Gelegenheit bietet, die 1971 geborene Gwenaëlle Aubry zu entdecken.
Die andere, die chronologische Ordnung fügt sich stückweise zusammen: das Kennenlernen der Eltern aus bürgerlichem Haus, ihre frühe Heirat, die Geburt zweier Töchter, die Trennung, als Gwenaëlle Aubry knapp fünf Jahre alt ist, die phasenweise sich verschlimmernden Beschwerden, ein Suizidversuch des Vaters zehn Jahre später, seine Rückkehr in die kleine Heimatstadt, wo er von der elterlichen Bleibe in die Anstalt gegenüber wechselt, das friedliche letzte Jahr in einer winzigen Pariser Wohnung, der Tod im Schlaf. Währenddessen lebt die Tochter ihr Leben, wie sie kann, wird selbst Mutter, Philosophin, Schriftstellerin.
Von klein auf ist die Tochter daran gewohnt, dass ihr Vater schlechte Zeiten durchmacht, "aufgedunsen, mit verschleiertem Blick und einem finsteren Lächeln". Diese kindliche Perspektive wählt "Niemand" jedoch nicht: Gwenaëlle Aubry hat sich freigeschwommen, ist in einen intellektuellen Austausch mit dem Vater getreten.
Der prägt den Text in sehr konkreter Weise: Das väterliche Vermächtnis stellt eine blaue Mappe mit zweihundert Manuskriptseiten dar mit der knappen Anordnung: "einen Roman daraus machen". Auszüge aus der Mappe, biographische Notizen oder allgemeine Reflexionen - "Krümel und Kiesel, die er in den Wäldern seiner Angst ausgestreut hat, Schätze und Strandgut" - ergänzen Erlebnisse und Gedanken der Autorin. Gwenaëlle Aubry integriert sie, kommentiert sie, antwortet ihnen. Sie wagt einen Dialog über Wahn und Tod hinweg, ein gemeinsames Kunstwerk: Nicht zuletzt das macht Besonderheit und Wert von "Niemand" aus. Die Auszeichnung des Buchs mit dem renommierten "Prix Femina" im Jahr seines Erscheinens in Frankreich 2009 ist verdient.
Letzte Fragen treiben die Plotin-Spezialistin um - und der einzige, doch letztlich verzeihbare Schwachpunkt des Buches ist es, den Vater mitunter zum Weisen zu stilisieren, der im Wahn ekstatische Erkenntnis findet. Der Bezug auf nietzscheanische Gedanken oder Schlagworte der Psychoanalyse legen das ebenso nahe wie Anklänge an Michel Foucaults "Wahnsinn und Gesellschaft"; zum Glück sind sie selten, denn "Niemand" benötigt sie nicht. Die Bilder und Begriffe, die der Text entwickelt, stehen für sich: der Vater als Clown, als schwarzes Schaf, als SDF (Obdachloser), als Polizist und Ganove - die Worte werden mit neuem Sinn angereichert.
"Niemand" nennt sich Odysseus, um den Zyklopen Polyphem zu täuschen: Nach der Blendung des einäugigen Riesen weiß dieser nicht, wer ihm das angetan hat. Aubry verweist nicht auf die "Odyssee", sie erwähnt vielmehr den Wunsch des Vaters, all die Rollen, die ihn bedrängen, abzuschütteln, sich der Leere zu stellen. Aber ein wenig schwingt die List des sagenhaften Griechen mit: Aubry klammert sich an ihren Vater, das schwarze Schaf, um mit seinen Worten dem menschenfressenden Riesen zu entkommen.
Am Ende sind beide befreit, dank einer ebenso dezenten wie hartnäckigen Tochterliebe, die zugleich eine Liebe zur Sprache ist.
NIKLAS BENDER.
Gwenaëlle Aubry: "Niemand".
Roman.
Aus dem Französischen von Dieter Hornig. Literaturverlag Droschl, Graz 2013. 152 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main