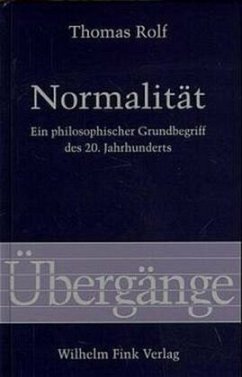Das Buch beschäftigt sich in bewußtseinstheoretischer Absicht mit einem Thema, welches in immer stärkerem Maße Einzug in philosophische Gegenwartsdiskussionen hält: mit der Frage nach Normalität. Bei dem Versuch, subjektphilosophische Bedeutung von 'Normalität' zu ermitteln, siedelt sich die Studie im Spannungsfeld pragmatistischer, phänomenologischer, psychoanalytischer und existenzphilosophischer Bewußtseinstheorien an.
Der Autor gibt einleitend eine begriffsgeschichtliche Darstellung des Normalitätskonzepts und wendet sich dann in fünf personenbezogenen Einzelstudien den Ansätzen von William James, Edmund Husserl, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre und Michel Foucault zu. Ziel der Untersuchungen ist der Nachweis, daß es sich bei den ausgewählten Positionen um Denkformen handelt, für die der Normalitätsbegriff als ein wesentliches Instrument zur Beschreibung der konstanten Strukturen menschlicher Subjektivität fungiert.
Der Autor gibt einleitend eine begriffsgeschichtliche Darstellung des Normalitätskonzepts und wendet sich dann in fünf personenbezogenen Einzelstudien den Ansätzen von William James, Edmund Husserl, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre und Michel Foucault zu. Ziel der Untersuchungen ist der Nachweis, daß es sich bei den ausgewählten Positionen um Denkformen handelt, für die der Normalitätsbegriff als ein wesentliches Instrument zur Beschreibung der konstanten Strukturen menschlicher Subjektivität fungiert.

Ist Normalität wirklich der Normalfall? Thomas Rolf lenkt das Auge des Individuums auf Selbstverständlichkeiten
Ist "Normalität" tatsächlich der Normalfall? Thomas Rolfs phänomenologisch-pragmatische Studie will den Nachweis erbringen, dass es normal ist, stillschweigend Normalität vorauszusetzen, um sich in der Welt zu orientieren. Dabei sieht sie sich mit einer verwirrenden Reihe von Zweideutigkeiten konfrontiert. Begriffsgeschichtlich ist das "Normale" geprägt von der unauflöslichen Ambivalenz zwischen Deskriptivem und Normativem, zwischen Beschreibung und Vorschrift. Diese Ambivalenz kommt auch in den beiden Erkenntnisstrategien zum Ausdruck, die bei der Bestimmung des "Normalen" historisch im Vordergrund standen: Seit Immanuel Kant in seiner "Kritik der Urteilskraft" dem Vorstellungsbild, das alle Individuen einer Gattung in sich vereinigt, den Namen "Normalidee" gegeben hat, verbindet sich mit dem "Normalen" die Idee eines statistisch erhebbaren Durchschnitts, wie ihn die gaußsche Normalverteilungskurve veranschaulicht.
Den "Durchschnittsmenschen" des belgischen Statistikers Adolphe Quételet konnten allerdings auch Francis Galtons Mischfotografien nur um den Preis sichtbar machen, die individuellen Züge beim Übereinanderprojizieren verschiedener Porträts zu löschen: Das "normale" Individuum ist nicht zu sehen. Seit Auguste Comte das Prinzip von François Joseph Victor Broussais, dass Krankheits- nur intensivierte Gesundheitszustände sind, auf den Gesellschaftskörper übertragen hat, ist deshalb immer wieder versucht worden, das "Normale" auf dem Umweg über das "Pathologische" genauer zu bestimmen; um den Preis, dass sich das "Normale" - im Gegensatz zum tatsächlich feststellbaren Pathologischen - als "Idealfiktion" (Sigmund Freud) erwies: Das "normale" Individuum ist nicht real.
Den konstruktiven Anteil dieser beiden historisch datierbaren, modernen Erkenntnisstrategien am Konzept der "Normalität" hat der Dortmunder Literaturwissenschaftler Jürgen Link in seinem "Versuch über den Normalismus" (siehe F.A.Z. vom 22. August 1997) herausgearbeitet und damit gleichzeitig die politische Instrumentalisierbarkeit, aber auch die Zerbrechlichkeit der "Normalität" dokumentiert. "Normalität" ist für die an Michel Foucaults historischer Kritik geschulte Diskursanalyse nichts selbstverständlich Gegebenes; sie wird hergestellt, sei es durch soziale und politische Maßnahmen der Normalisierung, sei es durch soziale und politische Maßnahmen der Normalisierung, die den Gesellschaftskörper im Auge haben, sei es durch Selbstangleichungen des Einzelnen an das "Normale" oder die symbolisch vermittelten Rückkoppelungen zwischen diesen beiden Vorgängen.
Insofern lässt sich Thomas Rolfs Versuch über die Normalität geradezu als Gegenprojekt zu Jürgen Links Diskursanalyse des Normalismus lesen, worüber auch gelegentliche Referenzen nicht hinwegtäuschen. Hier steht ein "Grundbegriff" zur Diskussion, der implizit die Philosophiegeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts getragen haben soll, kein Grundproblem, das sich spätestens bei der "Rückkehr zur Normalität" jeweils neu stellt. Rolf hegt das Konzept der "Normalität", indem er ihre begriffsgeschichtliche und erkenntnisstrategische Ambivalenz in der philosophischen Bewusstseinstheorie auffängt. Ausgangspunkt ist Wilhelm Windelbands Konzept einer Philosophie als Wissenschaft vom - unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen historisch immer schon gegebenen - Normalbewusstsein. Die empirischen Bedingungen dafür, dass es "normale beziehungsweise selbstverständliche Erfahrungen machen kann", ermittelt Rolf in anregungsreichen Exegesen ausgewählter Werke von William James, Edmund Husserl, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre und Michel Foucault.
Die deutsche Übersetzung von William James' "Common Sense" mit "gesundem" Menschenverstand soll deshalb unverfänglich sein, weil darin ein natürlich gegebener Gleichgewichtszustand zwischen dem erfahrungsgesättigten Beharrungsvermögen im vertrauten und einer die Grenzen der Selbsterhaltung nicht sprengenden Verstörbarkeit zum Ausdruck kommt. Diesen Glauben an die "Normalität", der das Weitergehen der Erfahrung trägt, teilt auch Husserl, in dessen Spätwerk der emphatische Begriff einer Philosophie der Letztbegründungen einer Hermeneutik der "selbstverständlichsten Selbstverständlichkeiten" weicht; ihre größte Herausforderung ist die "Normalität" des Bewusstseins. Dass sich diese "Normalität" bei Sigmund Freud beziehungsweise Jean-Paul Sartre ausgerechnet im Umgang mit dem Unbewussten beziehungsweise mit dem Tod bewährt, darf allerdings bezweifelt werden. Das Konzept "ästhetischer Selbstnormalisierung", das Rolf - trotz einer erhellenden Lektüre der Problematisierung von "Normalität" im Frühwerk über "Psychologie und Geisteskrankheit" - beim späten Foucault zu erkennen glaubt, ist gar eine haltlose Unterstellung, die sich auf keinen philologischen Befund stützen kann.
Im Verlauf der Abhandlung erweitert Thomas Rolfs hegemonialer Begriff der "Normalität" zusehends seinen Bedeutungshof und mündet schließlich ausdrücklich in eine "Ethik": Umfasst er zuerst die pragmatischen Orientierungsleistungen unseres Bewusstseins, ist zuletzt von der "Normalität menschlichen Glücksstrebens" als anthropologischer Konstante die Rede, die sich merkwürdig spiegelsymmetrisch zum unabweisbaren "Bedürfnis nach Normalität" verhält. Mit anderen Worten: Weil es "normal" ist, glücklich sein zu wollen, soll der Mensch "normal" sein wollen, um mit dem Glück der anderen nicht seinem eigenen Glück im Weg zu stehen. Mit Fug und Recht kann "ein in diesem Sinne normaler Mensch auch als Lebenskünstler bezeichnet" werden. Sein Byzantinismus im Umgang mit der "Normalität" gleicht allerdings einer Zwangsneurose.
MARTIN STINGELIN
Thomas Rolf: "Normalität". Ein philosophischer Grundbegriff des 20. Jahrhunderts. Wilhelm Fink Verlag, München 1999. 322 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main