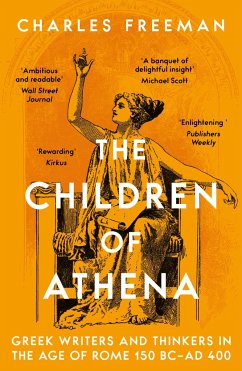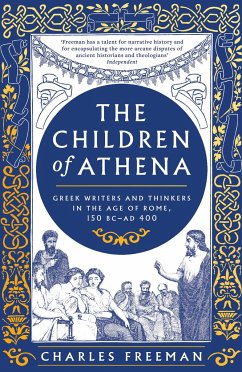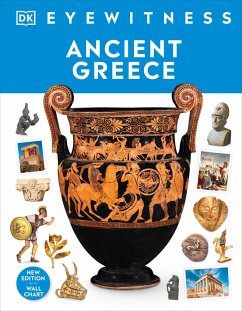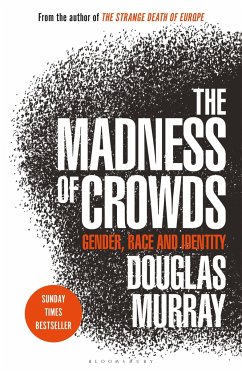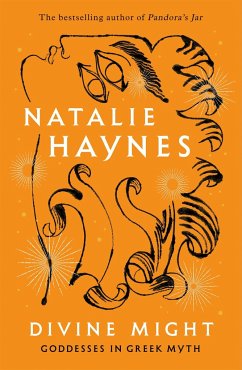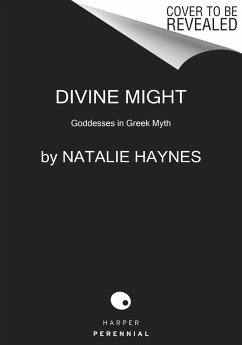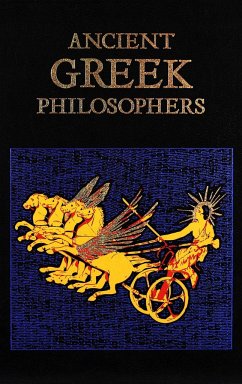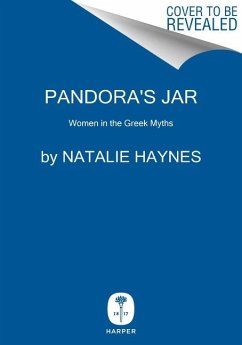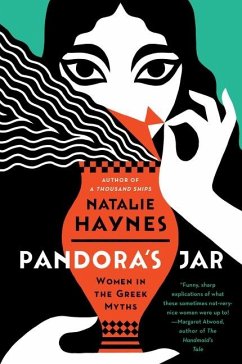Nicht lieferbar
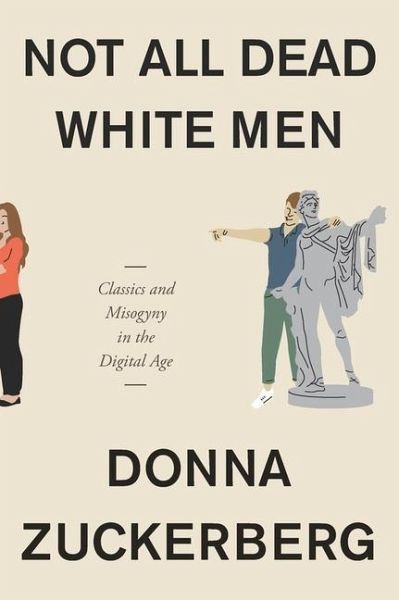
Not All Dead White Men
Classics and Misogyny in the Digital Age
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Some of the most controversial and consequential debates about the legacy of the ancients are raging not in universities but online, where alt-right men's groups deploy ancient sources to justify misogyny and a return of antifeminist masculinity. Donna Zuckerberg dives deep to take a look at this unexpected reanimation of the Classical tradition.