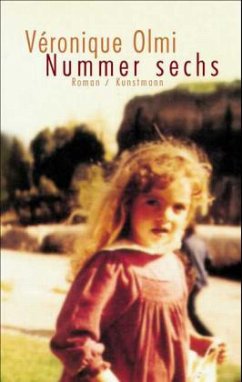Vorgestellt in Elke Heidenreichs LESEN! vom 09.12.2003!
"Die Geschichte hat mich so berührt. Es ist ein Buch über Versäumnisse, über Dinge, die man nicht mehr nachholen kann. Es ist auch ein Buch über diese kindliche Ungerechtigkeit, die man sein Leben lang bis zum Tod vermutlich mit sich herumträgt."
(Senta Berger)
Fanny ist das jüngste der Geschwister, Nummer sechs, wie der Vater sie gerne nannte. Der geliebte, stets anderweitig beschäftigte Vater, um dessen Anerkennung sie ein Leben lang kämpfte. Jetzt ist er alt, und Fanny hat es übernommen, ihn zu versorgen. Eine letzte Chance für sie, ihm endlich nahe zu kommen? Eine vorsichtige Annäherung findet statt, aber im Grunde ist es zu spät. Der alte Mann ist nicht mehr der autoritäre bewunderte Patriarch von früher, der ihr ganzes Leben geprägt hat, und von dem sie so gerne wüsste, was für ein Mensch er wirklich war.
Die Autorin erzählt hier mit großer Eindringlichkeit die Geschichte einer Frau auf der Suche nach ihrer Identität.
"Die Geschichte hat mich so berührt. Es ist ein Buch über Versäumnisse, über Dinge, die man nicht mehr nachholen kann. Es ist auch ein Buch über diese kindliche Ungerechtigkeit, die man sein Leben lang bis zum Tod vermutlich mit sich herumträgt."
(Senta Berger)
Fanny ist das jüngste der Geschwister, Nummer sechs, wie der Vater sie gerne nannte. Der geliebte, stets anderweitig beschäftigte Vater, um dessen Anerkennung sie ein Leben lang kämpfte. Jetzt ist er alt, und Fanny hat es übernommen, ihn zu versorgen. Eine letzte Chance für sie, ihm endlich nahe zu kommen? Eine vorsichtige Annäherung findet statt, aber im Grunde ist es zu spät. Der alte Mann ist nicht mehr der autoritäre bewunderte Patriarch von früher, der ihr ganzes Leben geprägt hat, und von dem sie so gerne wüsste, was für ein Mensch er wirklich war.
Die Autorin erzählt hier mit großer Eindringlichkeit die Geschichte einer Frau auf der Suche nach ihrer Identität.

Véronique Olmi erforscht komplexe Familienbande
Ein Roman, geschrieben in der Du-Form brieflicher Anrede - das kann wohl nur einer Theaterautorin gelingen. Die vierzigjährige Véronique Olmi ist durch Theaterstücke über zeitgenössische Befindlichkeiten mit zeitgeschichtlichen Anklängen über ihre französische Heimat hinaus bekannt geworden. Das Erzähler-Ich dieses schmalen Bandes, die Nachzüglerin einer kinderreichen katholischen Familie und inzwischen selbst alleinerziehende Mutter mittleren Alters, unterwirft sich in ihrer Schilderung ganz dem in der zweiten Person auftretenden Vater: einem Greis, der den patriarchalischen Glanz der früheren Jahre verloren hat. Mit kompensatorischer, gekränkter und doch ungetrübter Anhänglichkeit schmiegt sich das erzählende "Ich" an dieses vereinsamte "Du", das als junger Mann in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs gedient, unter Pétain dann dumpf etwas von "den Juden und Freimaurern" gemurmelt und später beim Autofahren im Rhythmus von "Al-gé-rie-fran-çai-se!" gehupt hat. Ein väterliches "Du", von dem die Nachzüglerin Fanny, "Nummer sechs" unter den Kindern, nie wirklich wahrgenommen und meist ohnehin mit einer ihrer Schwestern verwechselt wurde. Doch nun sitzt dieses "Du" stumm und hilfsbedürftig bei ihr in der Wohnung. "Bewundern kann man dich beim besten Willen nicht", heißt es da. Aber liebhaben irgendwie doch.
"Der Mann meines Lebens bist du", weiß die Erzählerin. Hätte sie geheiratet, dann nur deshalb, um an seinem Arm die Kirche zu betreten - "und niemals, niemals hätten wir den Altar erreicht". Was sie dem bewunderten Vater als Mädchen nie sagen konnte, weil er keine Zeit für sie hatte, kann sie dem Hundertjährigen nun auch nicht mehr mitteilen. So bleibt dieser innere Dialog in der Schwebe zwischen Gegenwart und Abwesenheit. In knappen Sätzen entsteht in den mehr skizzierten als narrativ ausgearbeiteten Kapiteln dieses Romans das Stenogramm eines Versuchs, mit dem Unausgesprochenen der Vergangenheit Frieden zu schließen. Schon in den Briefen des Vaters von der Front, welche die Tochter bei der Hausstandsauflösung nach dem Tod der Mutter an sich genommen hat, berühren das rauhe Papier und das offenbar auf den Knien hingekritzelte kantige Schriftbild die Lesende mehr als der Sinn der Worte. Den eigenen Bruder hat der junge Soldat dort an seiner Seite sterben sehen und trägt die Verletzung unter dem Panzer des herrischen Auftretens durchs ganze Leben.
Die so in den Schallraum des väterlichen "Du" getauchte Erzählerinnenstimme klingt jedoch nicht trocken, sondern tönt in einem reizvollen Doppelecho aus Glück und Melancholie. Wo es um den Alten still und leer wird und niemand ihn bei Tisch mehr auffordert, Valentins Aufbruchsarie aus Gounods "Faust" zu singen, entsteht Raum für den Empfindungswiderhall der Tochter. Dieser entfaltet sich in den feinsten Nuancen und bezieht auch andere Figuren aus dem Familienkreis mit ein. Die Mutter etwa, die mit launischen Einfällen ihren Platz an der Seite des Patriarchen gegen die Rivalität der Tochter verteidigt und diese bei der Bergwanderung zwingt, barfuß weiterzugehen, weil sie partout die Wanderschuhe des Mädchens anziehen will. Oder die Dienstmagd Maria in ihrem schäbigen Zimmer, deren unablässiges Stricken eine andere Art war, "Ich liebe dich" zu sagen. Oder auch den Bruder Christophe, der wegen einer unglücklichen Liebschaft aus dem guten Bürgerhaus verjagt wird, wodurch für Fanny ein Zimmer und ein Bett frei werden. Jedoch: "Das Bett war eiskalt, ich kriegte es nicht mehr warm."
Ein militanter Feministinnenroman hätte gezeigt, wie der herrische Patriarch Ursache für das unerfüllte Sekretärinnenleben dieser Frau ist, "ohne Mann und ohne Geld", wie Fannys Tochter Agathe ihr einmal vorwirft. Véronique Olmi jedoch bringt die ganze Komplexheit dieser Vater-Tochter-Beziehung zum Ausdruck, in der sich Liebe und Ressentiment ineinander verschränken. Wenn die kleine Fanny auf dem alljährlichen Familienfoto am Strand nicht im Bild ist, weil sie gerade eigensinnig ins Meer hinausspazierte, bis ihr blauer Hut auf dem Wasser schwimmt, dann war es der Vater, der auf der Stelle den Fotoapparat fallen ließ und sie auf den Sand zurücktrug. Darin muß ein Stück Zärtlichkeit gelegen haben, das bloße Verantwortung und Vaterpflicht weit überstieg. Auf dem Geburtstagsfoto, das die Tochter zum Hundertsten ihres Vater knipst, ist dieser allein im Bild. Und wenn er seinerseits bald vom Erdboden verschwindet, wird sie "da sein, wie du für mich einst da warst". Rettend einspringen wird sie jedoch nicht können. Sie wird ihn ziehen lassen mitsamt seinem Jahrhundert. Ihn haben die Kugeln des Ersten Weltkriegs verschont, sie hat der Mai '68 gerettet. "Ich demonstrierte. Ich nahm das Mikrofon, meine Stimme ertönte . . . und endlich sprach ich nicht mehr so wie du." Zwei entfernte Generationen reichen einander zum Abschied die Hand. Und die Bezeichnung "Roman" ist für diese knapp hundert Seiten, die Sigrid Vagt präzis ins Deutsche übersetzt hat, alles andere als Übertreibung.
Véronique Olmi: "Nummer sechs". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Sigrid Vagt. Verlag Antje Kunstmann, München 2003. 99 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
"Short Cuts, knapp erzählte Episoden von filmischer Eindringlichkeit" - so knapp eröffnet auch eine spürbar beeindruckte Sibylle Becker-Grüll ihre Besprechung von Veronique Olmis zweitem Roman. Er handelt von einer verspäteten Tochter, die hineingeboren wird in eine Familie, die eigentlich vollständig ist: "Frei ist lediglich der dürre Außenposten der Beobachterin." Ein halbes Leben lang, so Becker-Grüll, verharrt sie dort und ringt um etwas, das sie nie erlangt: die Liebe ihres Vaters, von der sie sich aber umso mehr abhängig macht. Irgendwann ist sie fünfzig und hat selber eine fast erwachsene Tochter, er ist hundert und todkrank, und sie hat ihn für sich - zum ersten Mal. Sie schaut zurück und zeichnet sein Bild - der bewunderte Mann, der verachtete Mann -, bis sie endlich im Sterbenden auch den "kreatürlich leidenden Menschen" sehen und beginnen kann, sich aus seinem Bann zu lösen. Olmi, schreibt Becker-Grüll, "erzählt diese unglückliche Kindheit in einem Ton milder Melancholie, der selten bitter klingt." Und mit einem tröstlichen Ende.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH