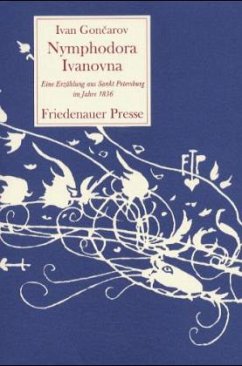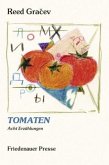Produktdetails
- Wolffs Broschur
- Verlag: Friedenauer Presse
- Seitenzahl: 102
- Deutsch
- Abmessung: 10mm x 122mm x 183mm
- Gewicht: 124g
- ISBN-13: 9783932109171
- ISBN-10: 3932109171
- Artikelnr.: 08859635
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Der junge Iwan Gontscharow Von Lothar Müller
Schon der Name schillert zweideutig: Nymphodora Iwanowna, das ist ein erlesener Aufschwung, der sich im Trivialen verläuft, eine Mesalliance des Erhabenen mit dem Lächerlichen wie, sagen wir, Hermione Meier. Die drei übermütigen Feen, die dabei Pate standen und das Zwitterwesen aus der Taufe hoben, wachten im Salon des Petersburger Hofmalers Nikolai Maikow über das Zusammenspiel von Schabernack, Pfänderspiel und rhetorisch-literarischem Wettstreit. Als der junge, eben aus der Provinz nach Sankt Petersburg gekommene Iwan Gontscharow in den Salon eingeführt wurde, hatten die Feen gerade den handgeschriebenen Almanach "Das Schneeglöckchen" gegründet und ihn in der Auflage von einem Exemplar zirkulieren lassen. Vor knapp zehn Jahren hat die Friedenauer Presse daraus Gontscharows Erzählung "Die Schwere Not" (1838) gehoben, nun ist sie nicht genug dafür zu loben, die im Almanach anonym erschienene "Nymphodora Iwanowna" (1836) nachgetragen zu haben.
Wenn es hinreißend schamlose Virtuosität gibt, hier ist sie. Der vierundzwanzigjährige Autor treibt in diesem von keiner Anfängerschüchternheit gehemmten Debüt den Schneeglöckchen des Salons das zarte Läuten aus. Seinen Stoff entnimmt er den trüben, abgründigen Seiten der Großstadt. Wie ein Lumpensammler kehrt er auf kleinem Raum einen ganzen Haufen von Ereignissen zusammen, wie man sie in den Zeitungen unter "Vermischtes", in der Rubrik "faits divers" findet: den plötzlich verschwundenen Ehemann, die gräßlich verstümmelte unbekannte Leiche, die verheerende Brandkatastrophe, den Ehebrecher, der den Mann seiner Geliebten umbringt, das Wiederauftauchen eines Totgeglaubten, das Scheitern eines fast vollkommenen Verbrechens, die Rache eines Verführten an seiner Verführerin. Das ist die Welt, in der die moderne Literatur ihre Blumen des Bösen finden wird, aber der junge Gontscharow erzählt davon, als hätte er einen kleinen Strauß Schneeglöckchen in der Hand, um ihn mit einer eleganten Verbeugung der Dame des Hauses als Gastgeschenk zu überreichen.
Es ist ein unheimliches Geschenk. Sehr nah führt trotz der demonstrativ guten Laune des Erzählers die Geschichte an die Regionen des aus dem Alltag aufsteigenden Wahnsinns und des Dämonischen heran, die E.T.A. Hoffmann und Gogol erschlossen haben. Fassungslos blickt Nymphodora Iwanowna in das Gesicht des Fremden, der so unverkennbar ihr totgelaubter Mann ist und doch bestreitet, es zu sein. Ein Schwindel ergreift sie, in dem aus der Anonymität der Großstadt eine Gewißheit hervorgeht, die ihr niemand glaubt. Unablässig ziehen vor dem inneren Blick des Mörders, der seiner Strafe entgegengeht, traumhaft scharfe Schreckensbilder vorüber. Den Damen, an die er sich gern mit Beschwichtigungen und Entschuldigungen für kapriziöse Abschweifungen wendet, erspart dieser quecksilbrige Erzähler den Blick auf die verstümmelte Leiche nicht. Ihn reizt es, aus der Kolportage mit leichter Hand die ernsthafte Beunruhigung herauszulocken. Ebendiese leichte Hand, nicht der düstere Stoff, den sie unter dem unschuldig-weißen Bild der Schneeglöckchen zusammenbindet, ist am Ende das wahrhaft Unheimliche. Mit schwungvoll-beiläufiger Geste löst sie den Knoten des unerhörten Kriminalfalls, und doch bleibt am Ende Nymphodora Iwanowna als Rätsel übrig. Sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Mann wiedergefunden, und die zweite Katastrophe war schlimmer als die erste. Aber sie geht wie unberührt durch die schauerliche Geschichte, und am Ende gibt die leichte Hand dem Leser den romantischen Wink, es sei hier von einer ganz außerordentlichen, unerschütterbaren Liebe die Rede gewesen. Aber dann war auch dieser Wink wieder nur eine Finte, und es bleibt durchaus ungewiß, ob die Heldin, die fast nur Zuschauerin war, am Ende in das ewige Entsetzen oder die behaglichen Freuden einer zweiten, durchaus gewöhnlichen Ehe eingeht.
Einmal macht sich der Erzähler über das leidenschaftslose Leben lustig, "das in weichen Sesseln dahindämmert oder über die Seiten eines neuen, auf alte Weise uninteressanten Romanes kriecht". Der junge Gontscharow, daran lassen Anspielungen wie diese keinen Zweifel, hat unter die lebenden Leichen, derer sich seine Erzählung annimmt, auch den zeitgenössischen Roman gezählt. Er hat auch diese Leiche wiederbelebt. Im Rückblick könnte man meinen, er habe sich in seinen frühen Erzählungen die Leidenschaften der verbrecherischen Liebe, der quecksilbrigen Unruhe und der hemmungslosen Lebensgier vom Hals geschafft, um Raum zu schaffen für den großen Roman über die Leidenschaft der Leidenschaftslosigkeit, den "Oblomow" (1859). Der Autor hinter diesem Denkmal schwerer Trägheit besaß sehr viel Witz und eine unheimlich leichte Hand. Das lehrt Nymphodora Iwanowna jeden, der es noch nicht weiß.
Ivan Goncarov: "Nymphodora Ivanovna. Eine Erzählung aus Sankt Petersburg im Jahre 1836". Aus dem Russischen übersetzt von Peter Urban. Friedenauer Presse, Berlin 2000. 104 S., br., 28 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Wolfgang Werth lässt in seiner Rezension des Buches keinen Zweifel daran, dass er sich bei der Lektüre glänzend amüsiert hat. Die Erzählung von 1835, die erst 1959 wiederentdeckt und 1993 erstmals gedruckt wurde - die Originalausgabe bestand nur aus einem einzigen, handgeschriebenen Exemplar - gilt als "definitiv erste Prosaarbeit" des russischen Autors, wie der Rezensent weiß. Das Buch bietet "Spannung, Rätselei und Spaß", versichert er. Besonders die vielen Einschübe und Nebengeschichten, die vom geschilderten "Kriminalfall" ablenken und den Rezensenten an so verschiedene Autoren wie Gogol, Jean Paul und Lawrence Sterne denken lassen, tragen für ihn zur Unterhaltung und zum Gehalt der Erzählung bei. Außerdem weist er auf das Geschick hin, mit dem der Autor den Leser anspricht, zum "Gesprächspartner" macht und ihn dadurch scheinbar an der "Herstellung des Textes" beteiligt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH