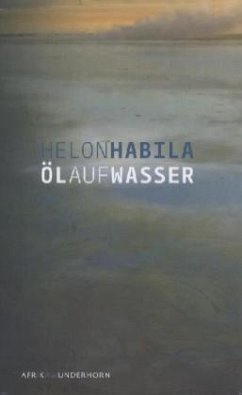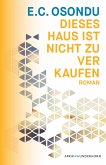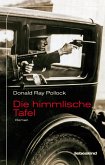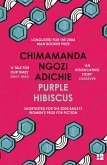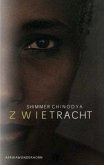Port Harcourt, Nigeria, im Delta des Niger. Eine Frau verschwindet.Dies wäre keine Nachricht in den Medien wert, handelte es sich nicht um eine Britin, die Ehefrau eines hochrangigen Mitarbeiters einer ausländischen Ölgesellschaft, die im Delta und vor der Küste Öl bohren. Die Entführung ist offensichtlich das Werk einer Rebellengruppe, die gegen die Ölgesellschaften kämpfen, die das Land ausbeuten und zerstören. Als eine Lösegeldforderung eingeht, wittert der junge Journalist Rufus die Chance zu einer großen Story und macht sich mit dem gealterten Starreporter Zaq auf die Suche nach der Entführten. Es wird eine Reise ins Delta des Nigers hinein, ins "Herz der Finsternis", in eine apokalyptische Welt. Mit wachsendem Entsetzen nimmt Rufus die Zerstörung der Umwelt wahr, die Eskalation der Gewalt, die je eigenen Profitinteressen, die die widerstreitenden Kräfte - Ölgesellschaften, Polizei und Armee, Politiker und lokale Würdenträger auf der einen Seite, die Rebellen mit ihren Sympathisanten auf der anderen - in den Auseinandersetzungen verfolgen, die Entmenschlichung auf beiden Seiten der Front. Opfer sind in jedem Fall die einfachen Menschen, Fischer zumeist, die im Delta des Flusses leben. Sie haben nicht die Mittel, sich zur Wehr zu setzen, ihre Dorfgemeinschaften werden zwischen den Fronten zerrieben, sie verlieren ihre Lebensgrundlage, werden vertrieben, müssen fortziehen, hin zur großen Stadt, an deren Rand sie stranden.Hoffnung vermittelt einzig ein Dorf auf der kleinen Insel Irikefe, das einen humanistischen, egalitären Gegenentwurf lebt, ähnlich dem, den Wole Soyinka in "Zeit der Gesetzlosigkeit" beschreibt: im Einklang mit der Natur, ihren Rhythmen und Gesetzen folgend. Hier findet Rufus' nach einem Brand körperlich und seelisch schwer verletzte Schwester Boma Ruhe, hier findet Rufus eine Liebe, hier schließt Zaq seinen Frieden ...Doch auch hier ist nicht alles so, wie es scheint. Wie überhaupt nichts so ist, wie es an der Oberfläche aussieht. DasGrab der Britin ist leer. Nur ein Stein ist darin begraben ..."Öl auf Wasser" ist Bildungsroman und Umweltkrimi zugleich, Politthriller und anrührende Liebesgeschichte.'Ein schlanker, atmosphärischer Roman - teils Thriller, teils Betrachtung der todbringenden Kosten der Ölpolitik in der Region. Ein klassischer Bildungsroman.' Daily Mail'Habilas Stil hat jene Mischung aus Eleganz und verdammt guter Geschichte, die wir mit Conrad und Graham Greene verbinden. Großartig.' The Times'Meisterhaft. Baut auf der Tradition des klassischen Detektivromans auf und funktiniert zugleich auf einer tiefer gehenden, metaphorischen und philosophischen Ebene. Habila besitzt die filmische Fähigkeit, Szenen in das Bewusstsein zu brennen.' Independent'Liest sich wie eine post-koloniale Antwort auf Conrads Herz der Finsternis.' Financial Times
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Erschüttert und beeindruckt ist Nicole Henneberg von diesem Roman des Nigerianers Helon Habila, der sie direkt in das Nigerdelta führte, das Shell und Co. in eine ölverseuchte Katastrophenlandschaft verwandelt haben. Ganz "unaufgeregt", dafür "psychologisch genau" erzähle Habila von zwei Journalisten, die sich aufmachen, die entführte Frau eines Ölkonzernmanagers zu suchen. Dabei stoßen sie nicht nur auf die verschiedenen Rebellengruppen, sondern auch auf das Militär und religiöse Gruppen, die sich ihren Glauben weder von Kalaschnikows noch von den Ölmillionen nehmen lassen. Ein "spannender Abenteuerroman", findet Henneberg, kunstvoll in Szene gesetzt und klug erzählt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Keiner wird verschont: In seinem mitreißenden, gut recherchierten Abenteuerroman "Öl auf Wasser" schickt Helon Habila zwei Journalisten auf eine Fahrt durch die grauenvoll verstümmelte Landschaft Nigerias.
Eine der grauenvollsten Umweltkatastrophen unserer Zeit vollzieht sich, von der Weltöffentlichkeit fast unbeachtet, im afrikanischen Nigerdelta: Aus alten Pipelines und verlassenen, nie gewarteten Bohrköpfen treten jährlich Zehntausende Liter Erdöl aus, die Boden und Wasser vergiften. Dazu jagen die offen brennenden Abgasfackeln Wolken von giftigen Schwermetallen in die Luft. Die Schäden für Mensch und Tier sind so brutal, dass selbst hartgesottene Weltkonzerne wie Shell sich unbehaglich fühlen und bei entsprechenden Forderungen schnell zahlen. Den beißenden Geruch, der das riesige Nigerdelta durchdringt, kann man auch bei uns riechen - vor allem an den Tankstellen von Shell (dem Hauptölförderer im Delta). Von der idyllischen Flusslandschaft, die dort vor fünfzig Jahren noch existierte, ist kaum etwas übrig.
Vor diesem brisanten Hintergrund spielt Helon Habilas spannender Abenteuerroman "Öl auf Wasser". Er erzählt ganz unaufgeregt, aber psychologisch sehr genau von den Folgen der Ölpest und dem Krieg, den verschiedene Rebellengruppen dort gegen die Ölkonzerne ausgerufen haben. Die Regierung schützt die ausländischen Firmen und ihre Mitarbeiter mit mobilen Einsatztruppen - was auch nötig ist, denn die Rebellen benutzen diese Weißen als wandelnde "Geldbäume", von denen man jederzeit Dollarmillionen pflücken kann. Womit wir schon mitten in Habilas beeindruckender, sorgsam recherchierter Geschichte sind: In Lagos wird die Frau eines englischen Ölingenieurs entführt, und ihr Mann bittet den berühmten Journalisten Zaq, Kontakt mit den Rebellen aufzunehmen um herauszubekommen, ob seine Frau noch lebt.
Eigentlich ein Routineauftrag - doch als Zaq und seine Begleiter zum vereinbarten Treffpunkt kommen, finden sie nur noch die Reste eines Massakers. Da meldet sich in dem alternden Zaq, der beruflich abgestürzt und versoffen ist, gegen jede Vernunft sein politischer Jagdinstinkt zurück. Mit verzweifeltem Mut stürzt er sich in dieses Abenteuer, das vielleicht seine letzte Chance auf eine große, wichtige Story ist. Und er provoziert den zögerlichen Rufus, der ihn bewundert und eher aus Fürsorglichkeit begleitet, mit der ständigen Frage: Warum bist du eigentlich Journalist geworden?
Den Gang der Dinge zu ändern ist auch für Journalisten kaum möglich. Sie können nicht mehr tun, als geduldig ein paar Wahrheiten aufzulauern und darüber zu schreiben. Um die widersprüchlichen Gefühle, die dieser schwierige Status auslöst, geht es bei dieser Flussfahrt, und wie bei Joseph Conrad führt sie im doppelten Sinne ins Herz der Finsternis: in eine apokalyptische und grauenvoll verstümmelte Landschaft und in die Seele der Reisenden, die angesichts der elementaren Wucht der Ereignisse nicht nur räumlich die Orientierung verlieren. Rufus ist ein von Angst, Hunger und Hitze ständig überforderter Erzähler, der nur noch reflexhaft beobachtet und die Bilder wie eine Kamera aufnimmt, scheinbar ohne zu werten oder zu sortieren. Und genau darin besteht das sehr überzeugende Erzählkonzept: Weil sich immer wieder in den heikelsten Momenten seine Erinnerungen vordrängen, entsteht eine vielschichtige und durch die Zeiten springende Geschichte mit einer kunstvoll-dramatischen Struktur. Rufus Körper hat die Gerüche und Geräusche der Dörfer und des Flusses aufbewahrt, er trägt den poetischen Blick, der die Spuren verlorener Schönheit aufspürt. Und er schleudert den blutjungen Reporter, sosehr der sich auch sträubt, in seine elende Kindheit zurück. Sie endete traumatisch, als durch Leichtsinn das illegale Öllager seines Vaters explodierte, seine Schwester verstümmelt und die Familie zerstört wurde.
Schicht für Schicht legt Habila mit liebevoller Geduld die Hintergründe dieser Schicksalsfahrt durch ein Totenreich offen: die Eheprobleme des britischen Paares, die sie zum idealen Opfer werden lassen; die Angst von Zaq, in dem elenden Zeitungsbüro, in dem er in Lagos gestrandet war, zu sterben, und die seelische Lähmung und Unentschlossenheit von Rufus. Sie durchmessen die ganze Absurdität und Grausamkeit eines aussichtslosen Krieges, treffen auf einen Major, der verblüffend dem wahnsinnigen Colonel Kurtz aus "Apokalypse Now" ähnelt und reden mit selbstverliebten Freiheitskämpfern, die halb verwirrt, halb geschäftstüchtig wirken und wie nebenbei morden. Mit filmischer Genauigkeit sind diese Szenen geschildert und brennen sich dem Gedächtnis ein, vor allem die beiläufigen, scheinbar unspektakulären: der Blick in hastig verlassene Zimmer oder auf eine flüchtende Familie in wackeligen Booten, eine klägliche Armada, die sich in unsichere Gewässer wagt. Rufus erlebt sogar an dem einzig heilen Ort des Romans, der Siedlung einer Sekte von Sonnenanbetern, in deren Krankenstation Zaq stirbt, eine spröde Liebesnacht. Zwar wird auch dieser Ort von Hubschraubern bombardiert, doch die unerschütterlichen Gläubigen bauen ihn wieder auf: eines der beiden vorsichtigen Hoffnungszeichen des Romans. Die Rückkehr von Rufus und das Zusammentreffen mit seiner Schwester dort geraten leicht süßlich - vielleicht die einzige Schwachstelle dieses grandiosen Buches.
Helon Habila, der 1967 in Nigeria geboren wurde, arbeitete nach seinem Literaturstudium lange als Journalist in Lagos, er kennt die armseligen Redaktionsstuben und die gnadenlose Hackordnung unter den Journalisten, die er so pointiert beschreibt. Sein klarer, lakonischer Stil ist weit von jeder Anklage entfernt, denn Rufus verwandelt als staunender, anfangs naiver Betrachter diese trostlose Welt in einen fruchtbaren Ort für Geschichten. Er will seiner zu schreibenden Story gerecht werden, stellt unermüdlich Fragen und entgeht so allen vorschnellen Antworten. Zuletzt, das ist das zweite Hoffnungszeichen, ist aus einem unsicher-ängstlichen Anfänger ein würdiger Nachfolger des lebensklugen Zaq geworden.
NICOLE HENNEBERG
Helon Habila: "Öl auf Wasser". Roman.
Aus dem Englischen von Thomas Brückner. Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 2012. 240 S., geb., 24,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Politik und Poesie gehen in der Schreibweise dieses Autors eine ungeahnte Verbindung ein, mit einer skrupulösen Genauigkeit, jenseits aller Klischees. Was dieses Buch so spektakulär macht, ist sein Verzicht auf allgemeine Thesen, auf vordergründige Moral, auf selbstverständlich scheinende Unterscheidungen zwischen Gut und Böse.« Helmut Böttiger Süddeutsche Zeitung