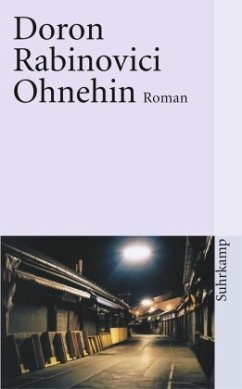Stefan Sandtner, Facharzt für Neurologie, kämpft gegen die Krankheiten der Erinnerung, aber er kennt kein Mittel, um eine Frau zu vergessen, die noch unlängst mehr als eine Kollegin für ihn war. Er nimmt sich eine Auszeit vom Klinikdienst. Nur einen Patienten, den er seit seinen Kindertagen kennt, behandelt er weiter: den alten Herbert Kerber, der sich nichts länger als 15 Minuten merken kann. Niemanden erkennt er wieder; nur die Kriegsjahre, über die er zuvor nie sprach, sind in aller Schärfe präsent, ja, er glaubt sich mitten in ihnen.
Ob allerdings das Heraufholen der Erinnerungen überhaupt erstrebenswert ist, darüber geraten die erwachsenen Kinder des Alten in Streit. Ist nicht das Vergessen eine Gnade? fragt sich der Sohn, zumal so am heilen Bild des Vaters keine Risse entstehen. Die Tochter hingegen veranstaltet mit dem Kranken Tribunale, die zu keinem Ende kommen, weil ihm vorher immer wieder alles entfällt.
Wenn er nicht bei seinem Patienten ist, treibt es Sandtner auf den Wiener Naschmarkt. Hier, inmitten heimischer und orientalischer Köstlichkeiten, trifft er alte Freunde und macht neue Bekanntschaften. An den bunten Ständen läßt er sich ihre Geschichten erzählen. Hier lernt er Flora Dema kennen, eine junge Filmemacherin aus Ex-Jugoslawien, die ihn in ihren Bann zieht. Mit ihr will Sandtner alle Probleme vergessen, ohne dabei zu merken, in welchen Nöten sie sich befindet.
Ob allerdings das Heraufholen der Erinnerungen überhaupt erstrebenswert ist, darüber geraten die erwachsenen Kinder des Alten in Streit. Ist nicht das Vergessen eine Gnade? fragt sich der Sohn, zumal so am heilen Bild des Vaters keine Risse entstehen. Die Tochter hingegen veranstaltet mit dem Kranken Tribunale, die zu keinem Ende kommen, weil ihm vorher immer wieder alles entfällt.
Wenn er nicht bei seinem Patienten ist, treibt es Sandtner auf den Wiener Naschmarkt. Hier, inmitten heimischer und orientalischer Köstlichkeiten, trifft er alte Freunde und macht neue Bekanntschaften. An den bunten Ständen läßt er sich ihre Geschichten erzählen. Hier lernt er Flora Dema kennen, eine junge Filmemacherin aus Ex-Jugoslawien, die ihn in ihren Bann zieht. Mit ihr will Sandtner alle Probleme vergessen, ohne dabei zu merken, in welchen Nöten sie sich befindet.

Unter Weißkitteln: Doron Rabinovici verhebt sich an einem Krimi
Im Sommer 1995, als Österreich unter dem Eindruck der Briefbombenserie im Namen einer fremdenfeindlichen "Bajuwarischen Befreiungsarmee" stand, läßt Doron Rabinovici seinen jüngsten Roman spielen. Daß die Anschläge, die vier Zigeuner, vom Täter politisch korrekt als "Roma" tituliert, das Leben kosteten, von einem einzelnen verübt wurden, wissen die Handelnden noch nicht. Dafür nimmt der Autor einen anderen Einzeltäter ins Visier, der noch heute als freier Mann in Wien lebt: Dr. Heinrich Gross war während des "Dritten Reichs" für die Tötung von Kindern in der Wiener Klinik "Am Spiegelgrund" verantwortlich, nach 1945 förderten die Sozialisten seine Karriere. Als er im Jahr 2000 vor Gericht kam, attestierte man ihm fortgeschrittene Demenz und damit Verhandlungsunfähigkeit.
Rabinovici nennt ihn Dr. Herbert Kerber und macht aus dem Verlust der Erinnerung das Movens seiner Geschichte: Kerber leidet unter dem Korsakow-Syndrom - völlige Desorientiertheit im Gegenwärtigen bei funktionierendem Langzeitgedächtnis, gewissermaßen das Gegenteil von dem, woran die Gesellschaft lange krankte. Der Held, der auf den ärzteromantauglichen Namen Stefan Sandtner hört, ist als Neurologe und Gedächtnisspezialist berufen, sich seiner anzunehmen, er kennt ihn schon lange, ist mit seinen Kindern aufgewachsen. Nun erforscht er die Wirkung eines Medikaments, das die Erinnerungsfähigkeit älterer Patienten erstaunlich zu verbessern scheint - Bärbl, Kerbers Tochter, erhofft sich davon vor allem ein umfassendes "Geständnis" ihres Vaters, der meint, als frisch besiegter SS-Offizier im Jahr 1945 zu leben. Hans, der Sohn, fürchtet genau das und bangt um seine Beamtenkarriere.
Stefan Sandtner verkörpert den gutwilligen, aber gedankenlosen Durchschnittstypen, eine farblose Figur, die nur komplementär sichtbar wird, als verlassener Liebhaber einer Ärztekollegin, als frischgebackener Liebhaber der aus Bosnien geflüchteten Kunststudentin Flora Dema. Mit ihr rückt Rabinovici den europäischen Krieg der erzählten Gegenwart, den Jugoslawien-Krieg, ins Bild und überblendet die Problematik von Kriegsverbrechen und Zivilcourage über die Jahrzehnte hinweg.
Selten liest man ein Buch, das so klug konzipiert und so gründlich mißraten ist. Mag sein, daß das eine mit dem anderen zu tun hat. Offenbar wollte der Autor alles hineinpacken, was an rot-weiß-rotem Zeitkolorit gut und teuer ist: Hans, der mittlerweile bürgerliche Nazisohn, war Kommunist, seine Schwester Bärbl Mitglied der berüchtigten Kommune des Aktionisten Otto Mühl. Stefans väterlicher Freund ist der weise alte Jude und Emigrant Paul Guttmann, in Stefans Clique gibt es einen jungen jüdischen Ausstellungsmacher, einen Schwarzen, eine höhere Tochter. Beleuchtet wird die verlogene Wiener Kunstszene ebenso wie der Naschmarkt, der mit seinem multikulturellen Flair, wie der Autor anmerkt, längst "zum Klischee geworden" ist, weshalb es "allzu billig" wäre, "ein idyllisches Bild zu zeichnen von bunter Vielfalt und froher Harmonie" - was ihn freilich nicht davon abhält, das zu tun.
Mit dem frohgemuten Fremden-Verkehr prägt "Ohnehin" ein Gegenklischee zu den düsteren Wienbildern, eine Kontrastfolie zu Nazizeit und Nachkriegsplackerei. Es gipfelt in der Liebesgeschichte zwischen einem Griechen (mit dem recht ungriechischen Namen Alexandrus) und einer Türkin: Romeo und Julia auf dem Naschmarkt, aber mit happy ending.
Der Roman wirkt, als hätte ein intelligenter, historisch versierter Autor sich eine reizvolle Aufgabe gestellt, um sie dann lustlos zu exekutieren. Daß Pflichtgefühl die treibende Kraft hinter dieser Anstrengung war, merkt man der orientierungslosen Sprache an, die sich immer wieder zu poetischen Verzweiflungstaten aufzuraffen scheint - und folgerichtig stets aufs neue abstürzt. "Aus seinem Mund blühte bitterweißer Rauch", heißt es da oder: "Flora lächelte. Ihre Hüften wiegten zum Rhythmus." Wenn Herr Dr. Sandtner fernsieht, klingt das so: "Einmal muß Schluß sein. Genug der Leichenberge, fort mit Krieg und Verbrechen. Fernsehen ohne Nachsicht. Er schaute, obgleich oder weil er nichts sah ... Hier sollte ihn der Lichterglanz aufheizen."
Eine fatale Vorliebe hat der Autor für die Verben "streichen" und "streifen". Der Finger "streicht" über den roten Knopf der Fernbedienung, "streift daran vorbei", Guttmann "strich an Fladenbrot, Laugengebäck ... vorbei", Stefan "flanierte" im (!) Kaffeehaus am Zeitungsgestell vorbei, ja er "strich" sogar "durch Bärbls Verhörraum": ein Kinderzimmer. Hier wird der Flaneur zum Zerrbild: Stefan "streunte" zum Naschmarkt, "brach sich einen Zopf vom türkischen Käse herunter, summte auf und rollte dabei die Augen".
Immerhin läßt sich das Buch als literarischer Kaffeehausführer verwenden, kaum ein In-Lokal, das hier nicht zum Schauplatz wird, auch solche kommen vor, die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Rabinovicis Bemühen, einer Folklore des Wiener "Schmähs" zu frönen, trifft freilich daneben, im großen wie im kleinen. Bei aller austriakischen Titellust: "Guten Morgen, Herr Sektionschef Doktor Kratochvil!" sagt kein Portier in Wien, "Herr Sektionschef" genügt. Vor all diesen Ärgernissen verblassen die wenigen geglückten Passagen, etwa die sehr witzige, in der ein alter Rabbiner vor jüdischem Publikum den Aufständischen im Warschauer Getto den Heldenstatus abspricht und die schockierte Übersetzerin die doppelten Verneinungen seines Jiddisch umdreht, um alles wieder in Ordnung zu bringen.
Ob nun "ohnehin" alles in Ordnung oder vielmehr alles "hin" ist, wie der sagenhafte liebe Augustin einst, der Pestgrube entstiegen, sang - der Titel läßt mehr offen als das Buch. Am Schluß verliert Stefan, ein lauer Liebender, seine Flora und bricht, vage geläutert, zu neuen Ufern auf.
DANIELA STRIGL
Doron Rabinovici: "Ohnehin". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 255 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Es gibt wenige Romane, in denen die Dialektik von Vergessen und Erinnern ... so komplex geschildert wird wie in Rabinovicis Roman.« Paul Michael Lützeler DIE ZEIT