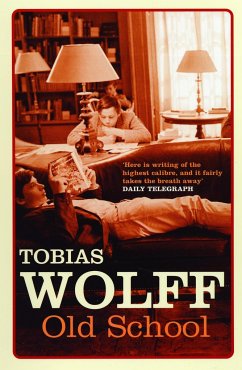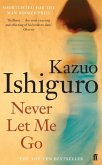At one prestigious American public school, the boys like to emphasise their democratic ideals - the only acknowledged snobbery is literary snobbery. Once a term, a big name from the literary world visits and a contest takes place. The boys have to submit a piece of writing and the winner receives a private audience with the visitor.
But then it is announced that Hemingway, the boys' hero, is coming to the school. The competition intensifies, and the morals the school and the boys pride themselves on - honour, loyalty and friendship - are crumbling under the strain. Only time will tell who will win and what it will cost them.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
But then it is announced that Hemingway, the boys' hero, is coming to the school. The competition intensifies, and the morals the school and the boys pride themselves on - honour, loyalty and friendship - are crumbling under the strain. Only time will tell who will win and what it will cost them.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Literatur ist Wahrheit und Notwendigkeit: Tobias Wolffs großer Roman "Alte Schule"
Es hat etwas mit Einsamkeit zu tun. Und mit Traurigkeit. Mit Glauben. Mit dem Glauben an die Macht der Literatur. Oder besser: dem Wissen darum. Darum, was Bücher vermögen. Darum, was wir meinen, wenn wir vom Lesen reden. Wenn wir austreten aus der Welt, hinein in die Welt eines Buches, die Welt der Literatur. Wenn wir ganz uns selbst gehören. Und der Wahrheit. Und dem Glück des Lesens. "In meinem Fall hatte es etwas mit Einsamkeit zu tun", schreibt Tobias Wolff auf meine Frage nach der Macht der Literatur und wer ihr erliegt. Und er schreibt, daß er allein bei seiner Mutter aufwuchs, daß sie den ganzen Tag weg war, um Geld zu verdienen, daß sie keinen Fernseher hatten, "Thank God!!!", schreibt er, und daß er las und las, O. Henry und Jack London und eine gekürzte Version der Ilias, die am Ende völlig zerrupft, zerhackt, zerlesen war, und daß Literatur sein Fenster war in die Welt und sein Kamerad.
Sein Kamerad.
Ich hätte ihn das eigentlich nicht fragen müssen. Denn sein neues Buch handelt genau davon. Vom Lesen und wie man da hineingerät in diesen Lesezauber und nicht mehr hinaus, wie aus der Liebe zu den Büchern eine Liebe zu den Schriftstellern entsteht und daraus irgendwann der Wille, selbst zu schreiben. Wie man also Schriftsteller wird. Das alles steht in dem Buch "Alte Schule", das gerade auf deutsch erscheint, und das wäre noch nichts Besonderes, denn Schriftsteller, die über das Schreiben schreiben und über das Lesen, die gibt es natürlich mehr als genug. Aber das Besondere und Herrliche und Unglaubliche an diesem Buch ist, daß es diesen Zauber nicht nur beschreibt, sondern daß dieser Zauber hier selbst entsteht. Daß er da drinsteckt. Daß das genau so ein Buch ist, das Dich verschluckt, Leser, und Du hineingerätst in eine Welt der Klarheit und der Wahrheit, die Du nicht verlassen willst, bis das Buch zu Ende ist, und danach eigentlich auch noch nicht. Das in Sätzen zu Dir spricht, die Du nicht vergißt. Und von Menschen erzählt, die Du lieben mußt. So ein Buch ist "Alte Schule" von Tobias Wolff.
Es ist ein Internatsroman aus dem Amerika von 1960. John F. Kennedy wird Präsident, aber hier, in der abgeschlossenen Schulwelt, erfährt man fast nichts davon. Es ist ein Elite-Internat. Hier sind die Reichen und Stolzen des Landes versammelt. Und - einige weniger Stolze und Reiche, die mit Hilfe eines Stipendiums hierhergekommen sind. Doch hier sind alle gleich. Alle sollten gleich sein, aber es gibt eben die, die ihr Leben und ihre Kleidung selbstbewußt tragen, und solche, die es nicht tun. Solche, die von Geburt an ihre Rolle in der Welt kennen und stolz darauf sind, und solche, die immer suchen werden. Nur in der einen Welt sind alle Suchende und Forschende und Neugierige und Unsichere. In der Welt der Literatur. Alle schreiben. Alle lesen. Alle bewundern und lieben die Dichter. Dreimal im Jahr kommt ein berühmter Schriftsteller für zwei Tage zu Besuch. Er hält einen Vortrag, hält Hof, und der Schüler, der die beste Geschichte, das beste Gedicht geschrieben hat, wird ausgewählt für eine Privataudienz am nächsten Morgen. Der Wettbewerb zwischen den jungen Schreibkräften ist hart, aber fair. Man schreibt um die Wette. Um die Ehre und den einen Moment, allein mit dem bewunderten Dichter.
Literatur als Gesetz
Unser Mann, der Ich-Erzähler Tobias, ist einer der Lebensunsicheren, Stipendiat aus armem Elternhaus, die Mutter fort, der Vater mittellos und Jude, vom eigenen Sohn verachtet. Die Armut und die halbjüdische Herkunft in einer christlich geprägten, lächelnd verborgenen, immer nur angedeutet antisemitischen Welt, das treibt Tobias mit noch größerer Macht in die Arme der Literatur. Denn im Leben mußten alle Gleichheit spielen und Sorglosigkeit: "Zwischen uns waren viele solcher Übereinkünfte entstanden. Niemals anzusprechen, wer wir wirklich waren - keine Sorgen, Schwächen oder Zweifel, keine Ängste, die unsere Zukunft betrafen oder welche Art Mann aus uns wurde. Niemals; nicht ein Wort. Wir hatten alles geistreich und abgeklärt gehalten, bis die Luft zwischen uns so durchironisiert war, daß ein ernsthaft gemeinter Satz unseren Verhaltenskodex, ja unser gegenseitiges Vertrauen verletzt hätte."
In diese Welt kommen die Dichter hinein. Zunächst der greise Robert Frost, der von der Kanzel herabpredigt auf die gläubigen Jungs, der den Lehrer, der ihm hohle Fragen stellt, erbarmungslos entzaubert und der von den Zeiten berichtet, als die Dichter die Gesetzgeber der Menschheit waren, und der jetzt den Schülern den Rat erteilt: "Täuscht euch nicht. Ein wahres Stück Literatur ist eine gefährliche Sache. Es kann euer Leben verändern." Dann kommt die Kolportage-Schriftstellerin Ayn Rand. Sie redet von Egoismus, Gesundheit und dem Willen zur Macht, von großen Helden und von der Erbärmlichkeit alles Kranken und Mittelmäßigen. Auch ein großer Auftritt für junge Menschen auf dem Weg zum Schriftsteller. Aber dann, wenig später, kommt die Ankündigung, die alles verändert. Im Speisesaal ist ein Toben und Pfeifen und Johlen und Jubeln wie im Tollhaus. Angekündigt wurde: der größte lebende Schriftsteller der damaligen Zeit. Angekündigt wurde: Ernest Hemingway.
Nach dem Jubel kommt die Ruhe. Das Schreiben. Das Schweigen und das Scheitern und die Verzweiflung. Wir sind dabei, wie einer alles gibt, um Schriftsteller zu werden, wie er alles gibt für einen Moment mit Ernest Hemingway. Tobias Wolff weiß alles über die Macht der Bewunderung. Und alles über das Leben auf dem Weg zum Schriftsteller. Und die Schwierigkeiten, es darzustellen: "Das Leben, das zum Schreiben führt, läßt sich nicht beschreiben. Es ist ein Leben, das selbst dem Schriftsteller unbewußt bleibt, unterhalb der Geschäftigkeit und der Geräusche des Geistes, in tiefen, unbeleuchteten Stollen, wo sich Phantomboten zu uns durchkämpfen und einander auf dem Weg umbringen; und wenn sich ein paar Überlebende zu unserer Aufmerksamkeit durchschlagen, werden sie so nüchtern empfangen wie der Kellner, der einen weiteren Kaffee bringt."
Und wie sich diese Phantomboten der Erinnerung dann zu einem Buch, zu einem so starken, intensiven Buch wie diesem zusammenfinden, das ist das Geheimnis des Genies. Tobias Wolff ist sechzig Jahre alt, lehrt in Stanford Literatur, begann sein Berufsleben als Erdbeerpflücker und Möbelpacker, bis er sich dann in einen sogenannten zweiten Bildungsweg hineindisziplinierte. Sein phantastischer Vietnam-Roman "In der Armee des Pharao" ist vor zehn Jahren auf deutsch erschienen, die Kindheitserinnerungen "This Boy's Life", die Flucht eines Jungen mit seiner Mutter von Ort zu Ort zu Ort durch ganz Amerika, die mit Robert de Niro und Leonardo DiCaprio verfilmt wurde, in der ersten anständigen Übersetzung ein Jahr später. Wolff, der in Amerika zur allerersten Schriftstellergarde gehört, ist in Deutschland immer noch erstaunlich wenig bekannt. Dabei ist er klarer, wahrer und radikaler als die meisten seiner schreibenden Landsleute. Und die deutschen Übersetzungen von Frank Heibert sind so gut, daß von dieser Klarheit und Kraft kaum etwas verlorengeht.
Bücher als Befehle
Und von diesen kleinen Momenten. Den Wolff-Momenten. Wie in seiner brillanten Erzählung "Kugel im Kopf", in der der Kunstkritiker mit seinem Leben dafür bezahlen muß, daß er alles immer rezensieren und ironisieren muß und den Bankräuber für einen Kunstgegenstand hält wie sein ganzes Leben. Wie der Held in "Pharaos Armee" im Armeelaster über die verminten Straßen Vietnams rast, auf der Suche nach einem Fernseher für die "Bonanza"-Sondersendung am Abend. Der kleine Junge, der in "This Boy's Life" von der Schule fliegt, und kurz davor heißt es über ihn, den wir lieben: "Die Lehrer dachten, ich wäre faul, bis auf meinen Englischlehrer, der sah, daß ich Bücher liebte, aber nichts über sie sagen konnte." Und dann also die Schule verlassen muß. Wie auch Tobias in dem neuen Buch, der schon früh die Vision seines Rauswurfs hatte und sich die Zugfahrt vorstellte und daran dachte, wie es sein wird, wenn er "Tag um Tag an Fabriken und Feldern und Wüste vorbeirollen würde, ohne irgend etwas wahrzunehmen, statt dessen nur mein erstauntes Spiegelbild auf der Scheibe". Und als er dann wirklich fliegt und am Bahnhof sitzt, und alles ist vorbei, und er denkt: "Dieses eine Mal war ich froh darüber, wie groß die Welt war." Und er fragt den Lehrer, der ihn zum Bahnhof gebracht hat, was denn sein Vater, den er doch nicht achtet und der gar nichts von ihm weiß, was denn der Vater gesagt habe, als er erfahren hat, sein Sohn fliegt von der Schule, und er sagt, "er hat dem Direktor nicht geglaubt, wir wüßten nicht das Geringste über dich, wenn wir glaubten, du würdest irgend etwas Betrügerisches tun, du seist der ehrlichste Mensch, den er kenne."
Das sind die Momente. Es gibt so viele davon.
Jetzt, in dem Brief, schreibt Wolff vom Tode Hemingways und wie er ihn als Fünfzehnjähriger erlebte. Wie groß seine Trauer und seine Erschütterung damals waren. Weil er die Geschichte liebte, schon damals, obwohl er nur wenig davon verstand. Aber die Menschlichkeit und Wahrheit, die verstand er schon. Und er schreibt von den anderen Schriftstellern Amerikas, die er kennt, und vor allem von Raymond Carver, dem am meisten bewunderten Schriftsteller und guten Freund, und er schreibt von seiner Trauer, heute noch, und dem Schmerz, daß es "nie wieder eine neue Geschichte geben wird von Ray" und daß er ihm nie wieder gegenübersitzen wird und er das nie wieder sehen wird, wie er blinzelt durch den Rauch einer Zigarette hindurch und seinen großen Kopf schüttelt aus Schrecken und aus Freude über die Enthüllung irgendeiner neuen dunklen menschlichen Merkwürdigkeit, über erstaunliche Menschen, erstaunliche Geschichten. Nie mehr.
Aber Wolff lebt noch. Und Wolff schreibt. Und er schreibt über diesen Jungen, Tobias, der Schriftsteller werden will, und er trifft diese Frau, die sein Leben aufgeschrieben hat, und er hat sich darin erkannt, wie er sich noch nirgendwo erkannt hat, und er trifft sie, und sie leugnet die Macht der Literatur, leugnet sie einfach, und er kann es nicht fassen, und er weiß, daß sie sich täuscht. So sicher wie sonst nichts: "Natürlich brachte Schreiben etwas Gutes. Und ich stand da, angetrunken und haltlos in dieser Menge schnarchender Männer, und sagte Dank für all das Gute, das es mir gebracht hatte."
VOLKER WEIDERMANN
Tobias Wolff: "Alte Schule". Roman. Aus dem Englischen von Frank Heibert. Berlin-Verlag. 250 Seiten, 19,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'Think Dead Poets' Society crossed with The Catcher in the Rye ... a beautifully crafted all-American coming-of-age tale' Esquire