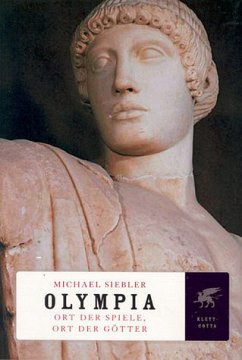Das Zeusheiligtum von Olympia war der bedeutendste Ort für die Verehrung des höchsten griechischen Gottes und Schauplatz der größten athletischen Wettkämpfe des Altertums. Seit mehr als 125 Jahren erforschen deutsche Archäologen den Ort, mit dem die olympische Idee untrennbar verbunden ist. Die Topographie der Ausgrabungsstätte wird anhand des aktualisierten offiziellen Lageplans im Buch dokumentiert.
Ebenso kenntnisreich wie anschaulich beschreibt Michael Siebler die archäologischen Funde und Denkmäler, die einst im heiligen Hain und seiner Umgebung standen. Zudem erfahren die Leser, welche persönlichen oder politischen Beweggründe hinter so manchen Weihegeschenken und Bauwerken, aber auch hinter der mythischen Überlieferung standen.
Kaum ein anderer Ort der Antike vermag so viel über griechisches Selbstverständnis, Architektur und Kunst gleichzeitig auszusagen wie Olympia, wo die besten Athleten der Welt um Sieg oder Niederlage rangen.
Ebenso kenntnisreich wie anschaulich beschreibt Michael Siebler die archäologischen Funde und Denkmäler, die einst im heiligen Hain und seiner Umgebung standen. Zudem erfahren die Leser, welche persönlichen oder politischen Beweggründe hinter so manchen Weihegeschenken und Bauwerken, aber auch hinter der mythischen Überlieferung standen.
Kaum ein anderer Ort der Antike vermag so viel über griechisches Selbstverständnis, Architektur und Kunst gleichzeitig auszusagen wie Olympia, wo die besten Athleten der Welt um Sieg oder Niederlage rangen.

Rechtzeitig vor den Sommerspielen: Vier Bücher über Olympia
Das Zeusfest und die Sportwettkämpfe in Olympia bilden so etwas wie ein Leitfossil der antiken griechischen Kultur. Mehr als eintausend Jahre lang veranlaßten sie Athleten und Besucher, alle vier Jahre den kleinen Ort in der Landschaft Elis an der Westküste der Peloponnes aufzusuchen, zunächst nur wenige und aus dem engeren Umkreis, später Zehntausende aus allen Regionen hellenischer Zunge und darüber hinaus. Der von einem antiken Gelehrten rekonstruierte und ins Jahr 776 vor Christus gesetzte Beginn der Siegerliste für die Urdisziplin, den Stadionlauf, markierte in der neuzeitlichen Forschung lange Zeit den Einschnitt, der das mythische vom historischen Griechenland trennte; mit den ersten Olympischen Spielen begann in dieser Sicht die antike Geschichte. Das vom christlichen Kaiser Theodosius I. Ende des vierten Jahrhunderts dekretierte Ende des Götterfestes konnte als einer der Endpunkte des paganen Altertums gedeutet werden. Danach verschwanden die Überreste der antiken Bauten unter einer meterhohen Schwemmsandschicht, doch bereits den Humanisten war der Ort wieder präsent.
Dafür sorgte in erster Linie Pausanias, der im zweiten Jahrhundert nach Christus in seiner "Beschreibung Griechenlands" die Bauten und Kunstwerke Olympias erheblich ausführlicher schilderte als selbst die athenischen. Was die griechischen Staaten in ihren Schatzhäusern und im Umkreis der Tempel an Weihgeschenken für Zeus und die anderen Götter aufstellten, wuchs so im Laufe der Zeit zu einem "Archiv der hellenischen Geschichte in Erz und Marmor", wie es der Historiker und Archäologe Ernst Curtius (1814 bis 1896) idealisierend formulierte. Jacob Burckhardt nahm dieses wirkmächtige Wort des Mentors und Leiters der ersten deutschen Olympiagrabung bewußt auf, drehte es aber in eine ganz andere Richtung, indem er Olympia als "das große monumentale Museum des Hasses von Griechen gegen Griechen, mit höchster künstlerischer Verewigung des gegenseitig angetanen Herzeleids" charakterisierte. In der Tat sollten Denkmäler wie die berühmte Nike des Paionios an militärische Siege erinnern. Diese Verbindung des Heiligtums mit dem Krieg war schon eng, als Olympia in der Frühzeit zunächst als Orakelstätte Bedeutung erlangte; weil die Weissager aber meist im "Außendienst" auf den Schlachtfeldern tätig waren, hat diese erste Karriere des Platzes nur wenige Spuren hinterlassen. Warum andererseits später der Waffenlauf zu den weniger prestigeträchtigen Disziplinen gehörte, ist bisher noch nicht befriedigend erklärt worden. Möglicherweise mangelte es ihm an Schönheit.
Starkult der Athleten
Die Rückkehr der Olympischen Sommerspiele nach Griechenland in diesem Jahr hat gleich vier Verlage veranlaßt, jeweils ein Buch über das antike Olympia herauszubringen. Bei allen Unterschieden ist ihnen eines gemeinsam: Der pseudo-aufklärerische, die Differenzen zwischen Antike und Moderne ebenso wie den geistigen Traditionszusammenhang einebnende Sensationsfuror, die antiken Spiele als unheilige zu entlarven, spielt keine große Rolle, und das mit Recht. Denn was hilft es zum Verständnis des Phänomens zu wissen, daß es "schon damals" Politisierung und Korruption, Starkult und Selbstzerstörung der Athleten gab? Daß einzelne prestigeträchtige Sportler als Startgeld angeblich eine Summe erhielten, für die ein Handwerker jahrzehntelang arbeiten mußte? Oder daß das Areal immer wieder eine Baustelle war, auch während der Spiele, weil es zum Beispiel mehr als zwanzig Jahre brauchte, den großen Zeustempel zu errichten? Eine derartige, als Denkmuster weit verbreitete Aktualisierung gehört deshalb überwunden, weil sie aus der Kammerdienerperspektive das Geschichtliche zugunsten eines angeblich konstant Allzumenschlichen uniformiert und nichts als Langeweile produziert.
Alle vier Bücher ruhen statt dessen - bei sehr unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen - auf einem gedanklichen Dreischritt. Aus den verhältnismäßig reichen Schriftquellen läßt sich zunächst zusammentragen und rekonstruieren, wie Olympia einst aussah und was sich dort während der festlichen Spiele, aber auch in der Zeit dazwischen abspielte. So hat Rosmarie Günther ihre Darstellung ganz um den Bericht des Pausanias, den "Reiseleiter", herumgebaut - was sie nicht hindert, zugleich die "weibliche" Seite von Kult und Geschichte thesenfreudig herauszustellen und sogar Muttergottheiten an den Anfang des Heiligtums zu setzen. Das zweite Thema ist die archäologische Wiedergewinnung der gesamten Anlage durch die Grabungen des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. Den höchst spannenden Subtext dieser Geschichte bildet die Transformation der klassischen Archäologie als einer Wissenschaftsdisziplin, die an ihren ästhetisch-normativen Wurzeln zusehends irre wurde, ohne sich vollständig der reinen historischen Erkenntnis verschreiben zu können - schon wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit, die dieser altertumswissenschaftlichen Disziplin weit mehr als anderen zuteil wurde und wird. Über den anderen Rezeptionsstrang in Gestalt der verschiedenen Ansätze zur Erneuerung der Spiele, von den "Olimpick Games" von Cotswold im England des frühen siebzehnten Jahrhunderts bis zu den mit dem Namen Pierre de Coubertin verbundenen Wettkämpfen seit 1896, orientiert Judith Swaddling in einem knappen Ausblick ihres informationsreichen Überblicks, für den auch ein neues Modell der Gesamtanlage angefertigt wurde. Am Ende des Dreischritts steht als Synthese idealerweise ein präzisiertes und historisch differenziertes Gesamtbild.
Michael Siebler gibt der Forschungsgeschichte breiten Raum, angefangen von Winckelmanns Hoffnung, unter dem Sand des Flusses Alpheios ließen sich originale Bildwerke aus der Blütezeit der griechischen Kunst in großer Zahl wiedergewinnen. Eine Grabung in Olympia war seit dem achtzehnten Jahrhundert im Gespräch, und es kam nur noch darauf an, wer als erster die zahlreichen Schwierigkeiten überwinden würde. Schließlich war es Ernst Curtius, der eine zufällige Nähe zum preußischen Hof und sein Talent zu einer öffentlichkeitswirksamen humanistischen Werbung für die Antike zu nutzen vermochte, damit das erste archäologische Großunternehmen des neuen Deutschen Reiches Wirklichkeit werden konnte. "Was dort in der dunkeln Tiefe liegt", so Curtius 1852 in einem programmatischen Vortrag, "ist Leben von unserem Leben." Und Leo von Klenze wußte schon 1821: Sobald "teutsche Forscher diese Entdeckungsfahrt nach dem geheiligten Boden Olympias antreten, werden die Kunstgebilde des Phidias und Myron willig aus ihrem feuchten Grab erstehen und zu uns herüberwandern, wo unser Jubel diese Besieger der Jahrtausende empfangen soll."
Der 1874 mit Griechenland geschlossene Vertrag, der den Deutschen alle Kosten und dafür auch alle Publikationsrechte einräumte, die Fundobjekte aber bis auf wenige Ausnahmen Griechenland überließ, war aus heutiger Sicht eine "grabungspolitische Epochenwende" und zugleich ein zukunftsweisendes Stück auswärtiger Kulturpolitik, damals jedoch hoch umstritten, da es zuwenig Prestige versprach, nur Papier und Abgüsse nach Hause zu bringen, nicht aber kostbare Schaustücke für die Berliner Museen, wie dies Carl Humann aus Pergamon und Heinrich Schliemann aus Troja und Mykene gelang. Bismarck, in dieser Hinsicht reichlich unsensibel, wollte deshalb sogar der Abschlußkampagne die Finanzierung verweigern. Insgesamt war wohl keine archäologische Ausgrabung im Ausland so eng mit der deutschen Geschichte und mit deutschem Nationalbewußtsein verknüpft, auch im Wettbewerb mit den Franzosen, die sich schon früher um Olympia bemüht hatten, um dann seit 1892 die großen Ausgrabungen in Delphi durchzuführen. An Olympia entwickelte sich auch ein breitgefächerter archäologischer Wissenschaftsjournalismus, der die jeweils aktuellen Funde und Ergebnisse allen Interessierten bekanntmachte.
Die hochgespannten Erwartungen an die Olympiagrabung und ihr Verlauf zeigen, wie aus Sieblers Bericht ebenfalls hervorgeht, eine Gemengelage in der Entwicklung der Archäologie: Auch Curtius und seine Mitstreiter waren vom Impuls der Schatzgräberei nach Meisterwerken der antiken Kunst, die sie an Heinrich Schliemann so kritisierten, nicht ganz frei. Als dann aber die Ausbeute an Siegerstatuen und Statuenweihungen an Zeus und die anderen Götter des Heiligtums hinter den Erwartungen zurückblieb, weil die ursprünglich nach Hunderten zählenden Stücke offenbar schon in der Antike verschleppt beziehungsweise eingeschmolzen worden waren, trat das historistisch-positivistische Paradigma in den Vordergrund: "Wichtiger sind die Aufschlüsse, die die Wissenschaft in topographischer und architektonischer Hinsicht empfing", so machte Wilhelm Dörpfeld rückblickend im "Baedeker" von 1908 aus der Not eine Tugend, und der Würzburger Archäologe Ulrich Sinn schlägt in die gleiche Kerbe, wenn er aus heutiger Sicht von einer "wohltuenden Versachlichung" spricht.
Unsere Lektüre für August
Sinn, gegenwärtig Leiter einer internationalen Forschergruppe in Olympia, hat eine sehr detaillierte, passagenweise geradezu handbuchgleiche Synthese vorgelegt. Gelungen ist sein Versuch, die Etappen der Geschichte des Heiligtums von der mythischen Vorzeit bis zur Millenniumfeier 224 nach Christus in einer Reihe von Vignetten zu beleuchten. Dennoch bleibt die politische Bedeutung des Heiligtums teilweise unklar. Dieses stand mitnichten immer unter der Verwaltung eines Stadtstaates, sondern es bildete das politische Zentrum der nichtstadtstaatlich verfaßten Landschaft Elis und beherbergte daher auch etwa das Amtslokal der Ratsherren. Erst 472/71, bezeichnenderweise kurz nach einer Neuorganisierung des Zeusfestes, gründeten die Eleier eine Polis. Rosmarie Günther spricht mit Recht von einem enormen wirtschaftlichen und politischen Aufschwung, den das Heiligtum nach der endgültigen Unterwerfung zweier abhängiger Regionen durch Elis in den 470er Jahren nahm. Erst in dieser Zeit wurde der monumentale Zeustempel mit dem berühmten Kultbild des thronenden Gottes von der Hand des Phidias errichtet - in der Antike eines der Sieben Weltwunder -, nachdem der Herr des Heiligtums bis dahin wahrscheinlich in dem später der Hera gehörenden Bau residiert hatte.
Immerhin zeigen die von Sinn berichteten Beispiele eindrucksvoll, in welchem Ausmaß hier Erfolg und prangende Schau die gesamte Existenz nicht nur des Adels in Griechenland bestimmten und hochgradig politischen Charakter hatten. Olympia war die wichtigste Bühne der Selbstinszenierung vor einer panhellenischen Öffentlichkeit, und allein der Augenblick des Sieges zählte und verschaffte Unsterblichkeit, nicht die Objektivierung der Leistung in einem Rekord (der sich immerhin in einzelnen Disziplinen wie dem Diskuswurf hätte bestimmen lassen).
Eine vergleichende historische Anthropologie hätte hier weiterzubohren und zu fragen, warum die Hellenen als einzige antike Kultur diese extrem ästhetisierte, reglementierte und zugleich verabsolutierte Form des Sich-untereinander-Messens und der Überhöhung des Sieges entwickelt haben. Auch junge Perser wetteiferten miteinander im Reiten und Bogenschießen, aber Charisma und Autorität erwuchsen daraus niemandem, während ein Alkibiades auf seinen glanzvollen Olympiasieg verweisen konnte, um den athenischen Landsleuten Zuversicht für den Kampf unter seiner Führung einzuflößen. Huizingas "Homo ludens" und der Verweis auf Sport als anthropologisch konstantes Phänomen sind jedenfalls ungeeignet, eine angeblich auf die Griechen verengte Sicht zu überwinden.
Das Beste zu dieser Frage aller Fragen auch für Olympia sind immer noch Jacob Burckhardts Beobachtungen zum agonalen Prinzip als einer Achse hellenischer Mentalität und Lebensführung im vierten Band der "Griechischen Kulturgeschichte". Gelehrte wie Viktor Ehrenberg, Helmut Berve und Ingomar Weiler haben manches weitergedacht. Sieblers vier Seiten dazu sind zwar nicht eben tiefschürfend, doch die anderen Autoren setzen das hochgradig erklärungsbedürftige Phänomen umstandslos als gegeben voraus. In den Beuteweihungen im Heiligtum, von denen schon die Rede war, nur etwas verschämt "den unheiligen Aspekt gewonnener Kriege" (Günther) zu sehen führt jedenfalls nicht weiter, wenn schon die "friedlichen" Wettkämpfe mit einigem Recht als "war minus the shooting" (Nigel Spivey) apostrophiert werden können.
Allen vernünftigen Informationsbedürfnissen genügen die Bücher indes allemal. In manchen Passagen wünscht man sich sogar weniger Anekdoten und Details, dafür eben mehr Reflexion auf Grundsätzliches. Mit Plänen, Fotos und Zeichnungen ausgestattet, sind die Bände für einen Rundgang durch die Ruinenlandschaft aber ohne Zweifel ebenso geeignet wie zur Terrassenstuhlarchäologie, vielleicht an einem delirierenden Mittag im August, wenn das Fernsehen endlose Stunden lang die Vorrunde des olympischen Volleyballturniers der Frauen überträgt oder die Zwischenläufe der Männer über fünftausend Meter.
UWE WALTER
Rosmarie Günther: "Olympia". Kult und Spiele in der Antike. Primus Verlag, Darmstadt 2004. 176 S., 30 Abb., geb., 19,90 [Euro].
Michael Siebler: "Olympia". Ort der Spiele, Ort der Götter. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2004. 278 S., 62 Abb. u. Karten, geb., 25,- [Euro].
Ulrich Sinn: "Das antike Olympia". Götter, Spiel und Kunst. C. H. Beck Verlag, München 2004. 276 S., 85 Abb., geb., 29,90 [Euro].
Judith Swaddling: "Die Olympischen Spiele der Antike". Aus dem Englischen von Ursula Blank-Sangmeister. Verlag Philipp Reclam jun., Stuttgart 2004. 200 S., 97 Abb., br., 5,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Recht angetan zeigt sich Rezensent Uwe Walter von Michael Sieblers Olympiabuch, eines von Vieren, die nun, rechtzeitig vor den Olympischen Sommerspielen in Griechenland erschienen sind. Wie Walter berichtet, bildet die Forschungsgeschichte zu Olympia bei Siebler einen Schwerpunkt, vor allem die archäologischen Grabungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Walter hält fest, dass wohl keine archäologische Ausgrabung im Ausland so eng mit der deutschen Geschichte und mit deutschem Nationalbewusstsein verknüpft gewesen sei. Zudem habe sich an Olympia ein breitgefächerter archäologischer Wissenschaftsjournalismus entwickelt, der die jeweils aktuellen Funde und Ergebnisse allen Interessierten bekannt machte. Insgesamt gilt auch für Sieblers Buch, dass es wie die übrigen besprochenen Olympiabücher "alle vernünftigen Informationsbedürfnisse" befriedigt. Allerdings hätte sich Walter auch hier manchmal weniger Anekdoten und Details und dafür mehr "Reflexion auf Grundsätzliches" gewünscht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH