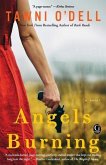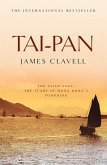Die Kulturgeschichte des größten Sportereignisses aller Zeiten: die Olympischen Spiele
Nach dem großen, von der Presse hochgelobten Erfolg 'Fußball. Eine Kulturgeschichte' nun das neue Buch von Klaus Zeyringer 'Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute'.
Sackhüpfen, Kanonenschießen, Seilklettern, so begann die Neuauflage der olympischen Spiele Ende des 19. Jahrhunderts. Schon daran zeigt sich, wie sehr die Idee des Barons von Coubertin in der damaligen Kultur verhaftet war; eine Geschichte der Olympischen Spiele muss also als Kulturgeschichte erzählt werden. Genau das macht Klaus Zeyringer: von den idealistischen Anfängen bis zum Massenspektakel von heute.
Er rückt die zentralen Etappen der Umsetzung der »Olympischen Idee« in den kulturellen und sozialen Kontext, schreibt über Amateurismums, die Bedeutung des Marathonlaufs, die Verstrickungen mit den politischen Mächten und zeigt uns den ganzen Reichtum und die Skurrilität der olympischen Welt des Sports - durch witzige Details, pointierte Anekdoten und die Einordnung in das große Ganze. Ein Lesevergnügen der besonderen Art.
Nach dem großen, von der Presse hochgelobten Erfolg 'Fußball. Eine Kulturgeschichte' nun das neue Buch von Klaus Zeyringer 'Olympische Spiele. Eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute'.
Sackhüpfen, Kanonenschießen, Seilklettern, so begann die Neuauflage der olympischen Spiele Ende des 19. Jahrhunderts. Schon daran zeigt sich, wie sehr die Idee des Barons von Coubertin in der damaligen Kultur verhaftet war; eine Geschichte der Olympischen Spiele muss also als Kulturgeschichte erzählt werden. Genau das macht Klaus Zeyringer: von den idealistischen Anfängen bis zum Massenspektakel von heute.
Er rückt die zentralen Etappen der Umsetzung der »Olympischen Idee« in den kulturellen und sozialen Kontext, schreibt über Amateurismums, die Bedeutung des Marathonlaufs, die Verstrickungen mit den politischen Mächten und zeigt uns den ganzen Reichtum und die Skurrilität der olympischen Welt des Sports - durch witzige Details, pointierte Anekdoten und die Einordnung in das große Ganze. Ein Lesevergnügen der besonderen Art.

Fünf Ringe sollen es sein: Rechtzeitig zum Beginn in Rio legt Klaus Zeyringer eine vorzügliche Geschichte der Olympischen Sommerspiele vor.
Olympiakritiker gab es immer schon. Sogar, als es gar keine Olympischen Spiele gab. Die Vereinigten Staaten hatten sich 1776 gerade von der britischen Krone gelöst und kämpften sich den Weg in die Unabhängigkeit frei, da verfiel ein Mitglied des Kontinentalkongresses in Philadelphia auf die Idee, der jüngste Staat der Erde möge unter seinen dreizehn Bundesstaaten Olympische Spiele abhalten, zur Wehrertüchtigung seiner Unabhängigkeitskämpfer. Die Idee war nicht mehrheitsfähig. Ein Abgeordneter lehnte die "funny declamation" mit der Begründung ab, gerade diese Art "Narretei" habe die Griechen "in ihre trostlose Lage" gebracht. Die Amerikaner gewannen ihren ersten Krieg trotzdem.
Aber was damals nicht sein sollte, würde rund hundert Jahre später werden. Es brauchte allerdings einen verlorenen Krieg dazu. Und Degeneration, Alkoholismus, krankhafte Grübelei, Verweichlichung von Körper und Charakter, die dafür verantwortlich gemacht wurden. Man darf sich Frankreich nach der Niederlage von 1870/71 nicht als glückliche Nation vorstellen. Und den jungen Pierre de Frédy, Baron de Coubertin, nicht als glücklichen Menschen. Sondern als einen Mann mit Ideen, Idealen und Visionen, wie die angeprangerten Schwächen zu überwinden seien. Coubertin stach damit unter seinen Zeitgenossen nicht besonders hervor. Aber während so viele andere Visionen des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts untergingen, trägt Coubertins nach und nach zu einem quasi-religiösen Mythos entwickelte Idee von der Wiedergeburt der Olympischen Spiele und der dazugehörigen Weltanschauung des Olympismus bis heute.
Jedenfalls in Pressemitteilungen: "Der Start des Olympischen Kanals am 21. August ist der Beginn einer aufregenden neuen Reise, um das globale Publikum das ganze Jahr über mit der Olympischen Bewegung zu verbinden", zitiert die Pressestelle des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) dessen Präsidenten Thomas Bach in einer Mitteilung vom 27. Juli. "Der Olympische Kanal wird uns alle inspirieren und neuen Generationen von Athleten und Fans die Hand reichen." Bach, seit 2013 Präsident des IOC, betont immer wieder: "Coubertin ist unter uns."
Der aber geißelte im Übrigen, neben den genannten Schwächen, unter denen er Frankreich leiden sah, nicht zuletzt auch den Geist der Gewinnsucht. Etwas ist eben doch verlorengegangen auf dem langen Weg von Coubertins Gedankenspielen zur Aufrichtung des französischen Bürgertums und insbesondere seiner Söhne im Geiste des Hellenismus bis zu den Profi-Spielen der globalisierten Medienwelt im 21. Jahrhundert.
Der Germanist Klaus Zeyringer hat nach einer "Kulturgeschichte des Fußballs" nun die Kulturgeschichte Olympias vorgelegt, genauer: den ersten, sommerlichen Teil. In Zeiten des staatlich organisierten Dopings und der Funktionärskleptokratie enthält sie die Nachricht: Früher war Olympia manchmal besser. Meistens aber genauso schlimm, mindestens, und oft schlimmer.
Schon die Geburtswehen des Olympismus wurden von allerlei Gewese hart an der Grenze zum Mummenschanz begleitet , was aber furchtbar ernst gemeint war. Aber wer will es dem jungen Baron im zweifelnden Frankreich vorwerfen? Schliemann hatte schließlich Troja gefunden, und Ernst Curtius grub zum Ruhme des Reichs im antiken Olympia. Da hatte er seinen Essay "Der Wettkampf" längst verfasst, wonach der Grieche sich über den Sport vom Orientalen im Allgemeinen und dem Juden im Besonderen abzuheben begonnen habe - und das "hellenistische Wesen" war bereits zum Leitbild des humanistischen Gymnasium aufgestiegen.
Coubertin zog mit, hielt sich, in Verkennung des antiken Athleten-Profitums, an die Ideale der englischen Gentlemen, nach denen das sportliche Vergnügen stets Ausdruck der reichlich zur Verfügung stehenden Zeit, niemals aber eines monetären Mangels sein müsse, und ließ sich von lokalen Spielen in halb Europa - von Ramlösa in Schonen über Much Wenlock in Shropshire bis Dessau in Anhalt - inspirieren. Am 23. Juni 1894 formiert sich an der Sorbonne das IOC. Damals wie heute gilt: Aufnahme durch Kooption. Seine undemokratische Verfassung stehe "in schreiendem Gegensatz zu den Tagesideen", so Coubertin, sei aber die "bewahrende Macht".
Sein Ideal der Völkerverständigung musste Coubertin schon beim Gründungsakt verraten. Deutsche hatten fernzubleiben, anderenfalls, hatten französische Sportverbände gedroht, boykottiere man die Veranstaltung. Gleichwohl: Olympische Spiele, so schwebte ihm vor, sollten einem Gesamtkunstwerk von Wagner gleichen. Am 6. April 1896, in Athen regnete es heftig, wurde Olympia erfolgreich wiederbelebt. Im Radfahren dominierten die Franzosen, im Turnen die Deutschen und beim Schwimmwettbewerb über 1200 Meter im Ägäischen Meer siegt der Ungar Alfred Hajos, geboren als Arnold Guttmann, den angesichts der hohen Wellen und des kalten Wassers "der Überlebensdrang stärker als der Siegeswillen" angetrieben hatte.
Weit schlimmer aber wurde es bei den folgenden beiden Ausgaben in Paris 1900 und St. Louis 1904. Diee Spiele fanden im Rahmen der Weltausstellungen statt, auf denen die Kolonialmächte zivilisatorische Überlegenheit zu demonstrieren gedachten. Den Spielen von St. Louis blieb Coubertin fern, weil der amerikanische Sportfunktionär James E. Sullivan sie selbst organisieren wollte. Sullivan hatte den bemerkenswert schäbigen Einfall, eigens Wettkämpfe für "mindere Rassen" auszuschreiben, und gab wohl auch den Impuls für die Wettkämpfe der "Anthropology Days", an denen das Personal aus den Menschenzoos abgezogen wurde, um sie überwiegend in olympischen Disziplinen antreten zu lassen. Coubertin nannte das "unmenschlich" und zeigte sich verstört über den Umgang mit seiner olympischen Idee. Olympia emanzipierte sich. Und doch, Zeyringers Buch zeigt das eindrucksvoll, ist es kein Wunder, dass nach vierzig Jahren Spiele der Neuzeit die Nationalsozialisten von ihnen Gebrauch machen konnten in grauenvoll perfekter Weise. Coubertin war für die Spiele in Berlin, die am 1. August vor achtzig Jahren eröffnet wurden, eingetreten. Ein Bekenntnis zu Internationalismus und Demokratie aber hatten die Deutschen zensiert, bevor sie seine Empfehlung verbreiteten. Später wurde Theodor Lewald, Mitglied der IOC-Exekutive und Organisator der Berliner Spiele, wegen seiner jüdischen Vorfahren auf Drängen Hitlers im olympischen Zirkel durch General Walter von Reichenau ersetzt, der die 10. Armee beim Überfall auf Polen kommandieren und an der Ostfront Kriegsverbrechen anordnen sollte.
Rund fünfzehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begannen dann die Fernsehbilder, die sich das IOC bald auch bezahlen ließ, sich im kollektiven Gedächtnis festzusetzen. Dawn Fraser und Armin Hary, Tommie Smith und John Carlos, der Schwarze September in München, Nadia Comaneci und Ben Johnson, Carl Lewis, Becker & Stich, Cathy Freeman und Usain Bolt. Bei Zeyringer findet man sie alle. Vor allem aber hat er ein anregendes, weil wunderbar ehrliches Buch über den Olympismus geschrieben
CHRISTOPH BECKER
Klaus Zeyringer: "Olympische Spiele". Eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute. Band 1: Sommer.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016. 608 S., geb., 26,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Christoph Becker schaut zurück auf die Helden von Olympia in Klaus Zeyringers Buch. Aber auch die Geburtswehen und die andauernden Schwierigkeiten mit Idealen wie Völkerverständigung und Internationalismus. Zeyringers Kulturgeschichte Olympias beschränkt sich laut Rezensent zwar auf die Sommerspiele, doch zeigt es ihm eindrucksvoll, ehrlich und auf anregende Weise, warum etwa Hitler die Spiele für sich instrumentalisieren konnte, wer alles Rekorde brach und warum der Olympismus einem Gesamtkunstwerk gleicht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Zeyringers erzählerisches Wechselspiel zwischen bedeutsamen Zusammenhängen und vermeintlich unnützem Wissen trägt Wesentliches zum kurzweiligen Lesevergnügen bei. Johannes Luxner Österreichischer Rundfunk 20180204