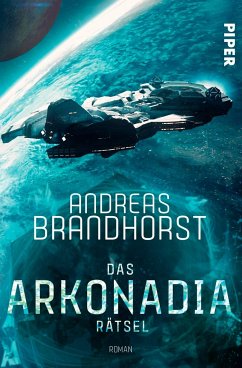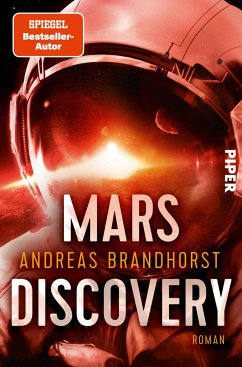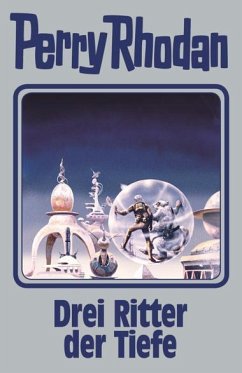Nicht lieferbar
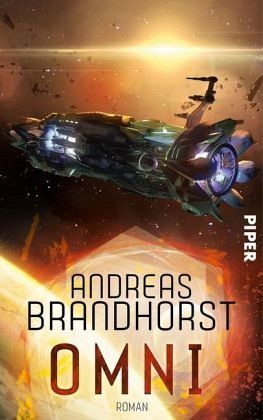
Omni
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Gewinner des Kurd-Laßwitz-Preises 2017! Aurelius, vor zehntausend Jahren auf der legendären Erde geboren, ist einer von nur sechs Menschen, die Zugang zu Omni haben, einem Zusammenschluss von Superzivilisationen, der die Macht über die Milchstraße innehat. Nun erhält Aurelius seinen letzten Auftrag: Er soll verhindern, dass ein rätselhaftes Artefakt an Bord des im Hyperraum gestrandeten Raumschiffs Kuritania in falsche Hände gerät. Eine einflussreiche Schattenorganisation ist dem Wrack bereits auf der Spur. Der Agent Forrester und seine Tochter Zinnober sollen den Fund bergen und Aurel...
Gewinner des Kurd-Laßwitz-Preises 2017! Aurelius, vor zehntausend Jahren auf der legendären Erde geboren, ist einer von nur sechs Menschen, die Zugang zu Omni haben, einem Zusammenschluss von Superzivilisationen, der die Macht über die Milchstraße innehat. Nun erhält Aurelius seinen letzten Auftrag: Er soll verhindern, dass ein rätselhaftes Artefakt an Bord des im Hyperraum gestrandeten Raumschiffs Kuritania in falsche Hände gerät. Eine einflussreiche Schattenorganisation ist dem Wrack bereits auf der Spur. Der Agent Forrester und seine Tochter Zinnober sollen den Fund bergen und Aurelius entführen - denn mit seiner Hilfe könnte das Artefakt wieder aktiviert werden. Doch die Mission gerät außer Kontrolle - und Aurelius, Forrester und Zinnober finden sich in einem undurchsichtigen Spiel wieder, das die Zukunft der ganzen Menschheit bedroht ...