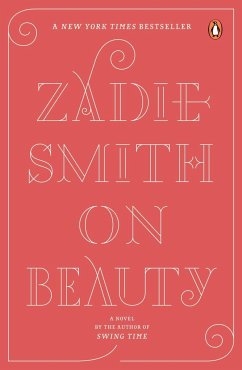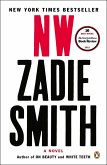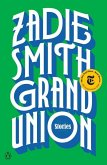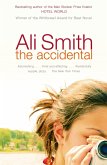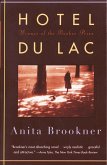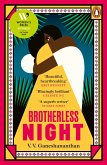Set on both sides of the Atlantic, Smith's third novel is a brilliant analysis of family life, the institution of marriage, intersections of the personal and the political, and an honest look at people's deceptions.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die englische Schriftstellerin Zadie Smith über Condoleezza Rice, Harvard-Studenten und den Unterschied zwischen Literatur und Musik
Eine Doppelhaushälfte im Londoner Stadtteil Kilburn. Zadie Smith, 30, wohnt hier zusammen mit ihrem Ehemann Nick Laird, der auch Schriftsteller ist. Nach ihrem Erfolgsroman "Zähne zeigen" (2000) und ihrem zweiten Buch "Der Autogrammhändler" erscheint jetzt ihr dritter Roman in der deutschen Übersetzung: "Von der Schönheit". Er ist ein Familienroman, der an einem College in der Nähe von Boston spielt, und Zadie Smith bringt einem die Personen dieses Romans so nahe, daß man erstaunlicherweise anfängt, sich beim Lesen mit ihnen zu verwechseln. Immer ist sie dabei auch ironisch, verraten würde sie ihre Protagonisten nie. Wir gehen ins Wohnzimmer, wo alles hellgrün und weiß ist und an den Wänden keine Bilder, sondern viele alte Spiegel hängen. Zadie Smith serviert Tee und dreht sich die dünnsten Zigaretten, die man je gesehen hat. Sie spricht mit dunkler Stimme und sehr schnell.
Ihr neuer Roman "Von der Schönheit" ist in England und Amerika sehr gefeiert worden. Und obwohl man erst mal darauf kommen muß, haben doch alle gleich bemerkt, daß Sie eine alte Geschichte neu erfunden haben: den Familienzwist aus Edward Morgan Forsters "Wiedersehen in Howards End". Warum?
Forster gehört zu den Schriftstellern, die ich sehr, sehr mochte, als ich Anfang Zwanzig war. Ich habe immer viel Dickens und Hardy gelesen und die Bücher von den Brontë-Schwestern. Aber von Forster habe ich alles gelernt: Wie man schreibt, wie man Charaktere anlegt - er ist bei allem ja auch immer sehr lustig. Also war das Ausdruck meiner Dankbarkeit. Wissen Sie, worum es bei Forster geht? Ums Moralisieren. Menschen, die immer meinen, daß sie im Recht sind, werden eindimensional, starrsinnig und flach. Meine Figuren haben dasselbe Problem.
Ihr Roman erzählt die Geschichte von zwei verfeindeten Professoren und ihren Familien. Der eine, Howard Belsey, ist ein linker Weißer, der an einem College in der Nähe von Boston lehrt; der andere, Monty Kipps, ein schwarzer Konservativer von der Uni in London.
Beide sind Rembrandt-Forscher. Sie sind beruflich Rivalen und politische Erzfeinde. Und sie kriegen ein Problem, als Howards Sohn sich in London in Montys Tochter verliebt und Montys ganze Familie kurz darauf für ein Gastsemester nach Boston zieht. Da können sie sich dann nicht mehr aus dem Weg gehen. Es ist das ganz große Familienchaos.
Daß er mit seinem Starrsinn nicht weiterkommt, merkt allerdings nur Howard. Monty ist bis zum Schluß der konservative Schwarze vom Typ Colin Powell oder Condoleezza Rice, der es geschafft hat und sich permanent vom schwarzen Rest absetzt. Man hat nicht gerade den Eindruck, daß Sie ihn besonders mögen.
Leute wie Colin Powell und Condoleezza Rice finde ich vor allem psychologisch interessant. Sie sorgen in der Black Community für viel Verwirrung und lösen in gewisser Weise auch Angst aus. Wann immer man etwas über Condoleezza Rice liest, tauchen diese seltsamen Vermutungen auf, daß sie lesbisch sei oder psychotisch. Daß sie möglicherweise einfach eine sehr erfolgreiche schwarze Frau ist, die sehr rechte Positionen hat und ihren Job ziemlich gut macht, will keiner so recht glauben. Ich ertappe mich selbst dabei, daß mir das immer wieder komisch vorkommt und ich nach psychologischen Erklärungen suche. Und das ist doch interessant: daß man, sobald die schwarzen Wurzeln für die politische Gesinnung einer Schwarzen keine Rolle spielen, sofort eine Störung vermutet.
Sie meinen also nicht, daß Schwarze ihren schwarzen Wurzeln politisch verpflichtet sind?
Ich teile die Positionen von Condoleezza Rice nicht, und wenn ich Kinder hätte, die in ihr eine Art Vorbild sähen, würde ich mir Sorgen machen. Trotzdem glaube ich nicht, daß sich jemand, nur weil er eine bestimmte Hautfarbe hat oder bestimmter Herkunft ist, für die Menschen, die dieselbe Hautfarbe und dieselben Wurzeln haben, einsetzen muß. Das ist eine Frage der freien Entscheidung. Sie zum Beispiel können sich Deutschland gegenüber verpflichtet fühlen, müssen es aber nicht. Sie könnten auch Engländerin werden und ich Deutsche, wie wäre das?
Das wäre toll. Allerdings finde ich Sie gerade sehr britisch.
Ich mich ja auch. Das hat aber gar nicht soviel damit zu tun, daß ich hier geboren bin. Ich liebe mein Land, weil ich die Bücher und die Kunst liebe, die von hier kommen. Also habe ich meine Gründe. Leute, die mit der Flagge herumlaufen, viel Lärm machen und nicht wissen, wer Henry V. war, sind für mich nicht englisch.
Amerikanerin wären Sie nicht gern?
Das entspricht mir nicht, da bin ich mir sicher. Als ich jetzt aber für acht Monate in Harvard war, hatte ich wirklich eine großartige Zeit dort und habe mich sehr wohl gefühlt. Es hat viele Vor- und Nachteile, wenn man Bücher schreibt und mit einem Mal so sehr in der Öffentlichkeit steht. Für mich gehörte es zu den allergrößten Vorteilen, plötzlich ein amerikanisches Publikum zu haben. Das kam völlig unerwartet, weil man als englische Schriftstellerin natürlich erst mal an eine Leserschaft aus England oder Europa denkt. In gewisser Weise habe ich für mich so Amerika entdeckt und das anti-amerikanische Gerede von zu Hause als sehr seltsam empfunden. Man kann Amerika nicht in einem Satz abhandeln. Es ist ein riesiges, in zwei Hälften gespaltenes Land, und die eine Hälfte ist von der anderen politisch völlig verschieden.
Ihr Roman spielt an einem College in der Nähe von Boston. In einer der lustigsten Szenen treffen sich Howards Kinder, Zora und Levi, zufällig bei einer Poetry-Slam-Session in einem Club. Levi ist mit seinen Rapper-Freunden da, Zora mit den Studenten vom Creative-Writing-Kurs, die alle ein bißchen so reden, als hätten sie zuviel Foucault und Judith Butler gelesen. Sie sitzen da wie kleine Professoren, die sich plötzlich im wahren Leben wiederfinden.
Das komische ist ja, daß, wenn man Student ist - und ich habe wirklich gerne studiert -, man sehr genau weiß, daß einen keiner mag. Niemand mag Studenten. Alle denken, sie seien lächerlich oder verrückt, und tatsächlich ist man das auch, weil man in kurzer Zeit so vieles so schnell lernt und randvoll ist mit diesem neuen Wissen. Das ist ein guter Stoff für Komödien.
Mußten Sie in Harvard Creative-Writing-Kurse geben?
Einen ja, das war Bedingung. Ich habe wirklich großen Respekt vor Leuten, die das können. Eine Menge großer amerikanischer Autoren macht das, aber wenn man ein guter Schriftsteller ist, ist man eben noch lange kein guter Lehrer. Ein guter Lehrer muß mit jungen Menschen umgehen können, was ich nicht besonders gut kann. Ich fand es schwierig, mit ihnen zu reden und mich daran zu erinnern, wie es ist, wenn man achtzehn ist. Außerdem muß man so vorsichtig sein. Sie sitzen da und zeigen dir all die Sachen, die sie geschrieben haben, was ja auch intim ist. Also dachte ich, es reicht, einen guten Geschmack zu haben und ganz gut lektorieren zu können. Aber darum geht es gar nicht. Man muß sie öffnen und ihr Selbstvertrauen stärken. Das ist eine Fähigkeit, die ich bewundere. Immerhin kommen viele meiner Freunde in Amerika aus solchen Programmen: Jonathan Safran Foer hat solche Kurse besucht, Jeffrey Eugenides, Franzen, ich meine, alle waren da mal.
Sie schreiben Ihren Familienroman als Dreißigjährige nicht aus der Perspektive einer Dreißigjährigen, sondern versetzen sich in Figuren jeden Alters hinein. Fällt Ihnen das leicht?
Ich habe mich selbst nie als klar umrissene Person empfunden und könnte wirklich nicht sagen, wer ich eigentlich bin. In meiner eigenen Wahrnehmung bin ich eher vieles auf einmal - vielleicht daher meine Vorliebe für viele verschiedene Charaktere. Mich befremdet das ja, daß so viele junge Autoren ständig glauben, einem über ein Alter ego mitteilen zu müssen, wer sie sind. Ich könnte das gar nicht. Man muß sich schon für ein besonders großes Wunder halten oder es selbst gar nicht fassen können, was man zum Beispiel alles für sexuelle Gewohnheiten hat, um so schreiben zu können. Mich interessiert diese Literatur überhaupt nicht. Es ist Literatur von Schauspielern: Sie sind die Stars, die anderen die Co-Stars in ihrem persönlichen Film. Worauf es mir ankommt, ist, zu verstehen zu geben, daß andere in derselben Weise lebendig sind wie man selbst; daß sie ihre Lieben haben und ihr Leid - und daß sie sterben werden.
Schicken Sie Howards Familie im Roman deshalb in ein Konzert von Mozarts "Requiem"?
Wenn Sie so wollen, ja. Konzertbesuche gehören doch zu diesen gemeinsamen Familienunternehmungen, zu denen allerhöchstens die Hälfte der Familie Lust hat. Aber von Mozarts "Requiem" sind alle berührt, sogar Howard, der sich für einen unerbittlichen Atheisten und Rationalisten hält.
Sie haben selber mal gesungen. Was ist für Sie der Hauptunterschied zwischen Musik und Literatur in der Möglichkeit, sich auszudrücken?
Wenn man mit Schriftstellern spricht, ist es eigentlich immer so, daß sie Musiker beneiden, weil Musikhören eine so unmittelbare Erfahrung ist: Du hörst ein Stück oder ein Lied - und das ist es! Sie kennen doch sicher das "Pulp"-Album "Different Class" von 1995. Auf diesem Album wird so unglaublich viel über England, über die Menschen und die Klassen gesagt - ich brauchte zwölf Bücher und könnte nicht annähernd dasselbe sagen. Das ist der Unterschied: Dylan schreibt einen Song, Christopher Ricks fünfzig Bücher. Musik ist intensiver und berührt direkter, was man auf Hochzeiten oder Beerdigungen beobachten kann. Jeder wünscht sich ein Lied und fände es nicht unbedingt passend, wenn auf seiner Beerdigung eine Seite aus, sagen wir, "Middlesex" vorgelesen würde. Ich wäre damit auch nicht einverstanden! Bei Rap-Musik, die in meinem Roman eine Rolle spielt, ist das etwas anderes, weil sie so textlastig ist. Ich verdanke da viele Anregungen meinem Bruder, der in der britischen Hip-Hop-Szene aktiv ist.
Man hat ja den Eindruck, daß Sie, so wie Sie Familienszenen beschreiben, in Ihrer Familie viel Spaß gehabt haben müssen.
Das hatten wir sicher. Meine Brüder und ich sind mit Monty Python groß geworden und mit der Fernsehserie "The Office". Für Engländer ist Comedy eine sehr ernste Angelegenheit! Wenn wir also vorm Fernseher saßen und eine neue Folge gesehen haben, wurde ununterbrochen geredet und analysiert, ob es funktioniert und auch tatsächlich lustig ist. "The Office" ist nicht bloß spaßig, man muß nicht die ganze Zeit lachen. Eher ist es auf eine Weise komisch und traurig, die dir so sehr das Herz bricht, daß du weinen mußt. Das war schön. Zugleich habe ich mich zu Hause aber auch fremd gefühlt. Haben Sie zufällig Scorseses Bob-Dylan-Film gesehen?
Ja.
Vielleicht erinnern Sie sich an den Anfang. Da erzählt Dylan, wie er in einem Haus, das sein Vater gekauft hatte, zum ersten Mal eine Country-Platte hört. Er hat plötzlich das Gefühl, er wäre jemand anderes, und stellt fest, daß er vielleicht nicht die richtigen Eltern hat. Der unvergleichliche Dylan sitzt da also mitten in Mittelamerika und fühlt sich fremd. Und vielleicht braucht man dieses Gefühl, um den Antrieb zu haben, überhaupt so etwas wie Kunst zu produzieren.
Interview Julia Encke
Zadie Smith: "Von der Schönheit". Verlag Kiepenheuer & Witsch. 518 S., 22,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main