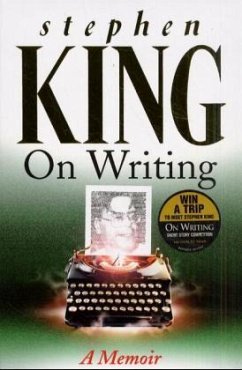Produktdetails
- Verlag: Hodder & Stoughton / Import
- Seitenzahl: 238
- Abmessung: 245mm
- Gewicht: 520g
- ISBN-13: 9780340769966
- Artikelnr.: 25188711
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Euch will er alle mit Haut und Haaren haben: Stephen King als bekennender Amerikaner / Von Georg Klein
Mit etwas Glück läßt sich irgendwo noch ein Lesender finden, der schlichtweg nicht weiß, wer Stephen King ist. Aber selbst dieser mediale Hinterwäldler bliebe, über Kings neuestes Buch gebeugt, nicht lange im Stand der Unschuld. In "Das Leben und das Schreiben" erführe er bald, mit welchem Kaliber von Autor er es zu tun hat: "Ungefähr drei Millionen Menschen haben ,Sara' gelesen, ich habe mindestens viertausend Briefe zu diesem Buch bekommen."
Jene Millionen sind es, von denen wir wissen, wenn wir den neuen King zur Hand nehmen. Wir reihen uns bei diesen Zahllosen ein, denn wir können davon ausgehen, daß erneut Hunderttausende dieses Buch kaufen und lesen werden, obwohl es sich weder um einen Horror- noch um einen Fantasy-Roman, sondern, wie es in fairer Warnung auf Stephen Kings Webseite heißt, um "non-fiction" handelt.
"Das Schreiben und das Leben" scheint auf den ersten Blick ein Bastard, denn die drei Hauptteile, in die es zerfällt, gehören zwei verschiedenen literarischen Welten an. Das erste Stück "Lebenslauf" und der schmale Schlußteil "Über das Leben: Ein Nachtrag" sind autobiographische Versuche, in denen King, geboren 1947, zunächst aus seiner Kindheit und Jugend, von seinem literarischen Werdegang bis 1985 und zuletzt von seinem schweren Autounfall im Jahr 1999 erzählt. Das Mittelstück "Was Schreiben ist" kann man mit Stephen King ironisch eine "Ars poetica" nennen. Auf gut hundertfünfzig Seiten versucht er an seinen Erfahrungen und an eigenen Textbeispielen zu demonstrieren, wie man das Prosaschreiben seiner Meinung nach am besten anpackt und vorantreibt.
Die King-Fans allerdings werden sich nicht um die weißen Seiten zwischen den autobiographischen Teilen und dem poetologischen Stück scheren, sondern das Buch als einen Happen verschlingen. Und ihr Gespür, die gute Nase des blinden Verehrers, hat recht: "On Writing", wie das Buch auf amerikanisch kurz und bündig heißt, ist, von vorne bis hinten, vom selben Fleisch - es ist eine Konfession. Und es lohnt sich, genau anzuschauen, wozu King sich bekennt, wem er sein Bekenntnis zu Gehör bringen will und was seine Beteuerungen als ihren unausgesprochenen Kern umreißen.
Ein Mann war zwölf Jahre Alkoholiker, er war von Medikamenten und Kokain abhängig, aber hat es mit Hilfe seiner Familie, mit Hilfe guter Freunde und aus eigener Willenskraft geschafft, den Suff und das Koksen aufzugeben. Dieser Mann liebt seine Frau und seine Kinder, er glaubt an Gott, und er sagt uns am Ende seines Buches, nachdem er das alles und noch ein bißchen mehr bekannt hat: "Es geht darum, glücklich zu werden, okay?"
Unser Mann hat sein Glück mit der Schriftstellerei gemacht, und deshalb ruft er all denen, die ihm auf diesem Weg nachfolgen wollen, zu: "Sie können es, Sie dürfen es, und wenn Sie genug Mut für den Anfang aufbringen, dann schaffen Sie es auch. Schreiben ist Magie, ist das Wasser des Lebens, genau wie jede andere kreative Kunst auch. Es ist umsonst. Trinket also."
Dieser Brustton, diese Missionarsrhetorik kommt uns noch nicht restlos amerikanisierten Alteuropäern doch verdächtig vor. Es scheint ratsam, vorsichtig an dem zu nippen, was uns ein bekehrter Trinker als das Gratis-Wasser des Lebens anbietet. "Umsonst" ist in den Vereinigten Staaten wahrlich wenig, vielleicht nichts, das kann man in Kings "Lebenslauf" aus manchem Detail lernen. So erzählt King, wie er als junger, noch erfolgloser Autor mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern von einem Besuch bei seiner krebskranken Mutter nach Hause kommt. Das Töchterchen Naomi hat plötzlich hohes Fieber bekommen, eine Mittelohrentzündung, und die Eltern wissen, daß sie den "Rosa Saft", das nötige flüssige Penicillin, nicht kaufen können, weil sie pleite sind.
Das ist anrührend und glaubwürdig erzählt, aber in ihrer Pointe enthüllt die Familienanekdote ihren ideologischen Zweck: Zu Hause angekommen, entnimmt der verzweifelte Vater dem Briefkasten einen Umschlag, findet darin nicht, wie befürchtet, eine weitere Rechnung, sondern einen Scheck des Herrenmagazins "Cavlier" über 500 Dollar, das erste größere Honorar, das King erhält.
So geht es in der Welt des Buches regelmäßig zu: Sein Held, der Autor King, kommt aus schwierigen Verhältnissen und hat mit den Schlägen des Lebens zu kämpfen. Aber weil er an das Recht auf Glück, weil er an seinen amerikanischen Gott glaubt und weiß, daß dieser Gott den bedingungslosen Kampf ums Glück erwartet, gibt er nicht auf, um schließlich belohnt zu werden.
Wer sind wir, daß Stephen King meint, uns den amerikanischen Bären aufbinden zu müssen? Wir sind seine Leser, und in "Das Leben und das Schreiben" ist oft von uns Lesern die Rede: "Ohne den treuen Leser sind wir nur quakende Stimmen im Nichts." Dies ist vielleicht die schönste Stelle, denn sie ist frei von der devoten Anbiederei, mit der in anderen Passagen um die Gunst der Leserschaft gebuhlt wird, und sie hat auch nichts von der dreisten Dominanz, mit der uns der Schreibschulmeister King seine meist dürftigen Ratschläge auftischt. In der schaurig komischen Vision vom Autor als einsam quakendem Frosch bleibt der Leser, genauer gesagt, bleibt die Fähigkeit des Autors, die Existenz seiner Leser zu phantasieren, die einzige Rettung aus Einsamkeit und Angst.
Stephen Kings neues Buch macht keine Angst - es hat Angst. Ich kann mich an kein zweites nichtfiktionales Buch erinnern, in dem so oft das Normalsein, der "klare Kopf" und der "gesunde Verstand" beschworen würden. King läßt keine Gelegenheit aus, zu beteuern, daß es in seinem Dachstübchen wie bei uns, bei seinen Lesern, mit rechten Dingen zugehe. "Wenn Sie allerdings meinen, ich ticke nicht richtig, auch gut." Mit dieser vorauseilenden Schutzgeste schließt King einen Absatz, in dem er die Planbarkeit literarischer Handlungen, das kontrollierte Ausdenken von Geschichten bezweifelt hat. Und in der Tat, hier liegt der Hund begraben: King weiß nicht, woher das kommt, was ihm beim Schreiben einfällt.
Rätselhaft sind ihm jene schrecklichen Einfälle, jene Ketten aberwitziger Handlungsideen, die seinen Erfolg ausmachen und um derentwegen man ihn, der in Sachen Beschreibung, Figurenzeichnung, Dialog, Reflexion und Stil knapp das amerikanische Mittelmaß erreicht, einen Großmeister des Plots nennen muß. Das gibt er offen zu, und wie er seinen Arbeitsalltag beschreibt, spricht Bände. Sein Verhältnis zur eigenen Kreativität ist ein magisches, er ist ein moderner Primitiver. Mit Ritualen, mit Beschwörungen und Dankopfern versucht er jenes Etwas in Arbeit, in Textproduktion, zu bannen, das er weder kontrollieren noch verstehen kann.
Es rührt an, wie ungeschickt und stockend der manische Schreiber King vom Werben um seine Muse, die zweifellos ein Dämon ist, zu erzählen versucht. Mit Sympathie sehe ich diesen einsamen Mann mit Bier und Kokain und schließlich mit Pepsi-Cola seine Privatriten an Schreibmaschine und PC verrichten. Aber zugleich bestürzt mich der verzweifelte Größenwahn, mit dem er in seinem neuen Buch den Fans das Schreiben beibringen will. Die Absicht ist klar: Wir sollen ihm nachfolgen. Denn wenn alle so würden wie er, wenn ihn Millionen kleiner Stephen Kings umwimmelten, könnte er endlich seiner Normalität sicher sein.
Vom Umschlag des Buches blickt uns der Autor King gütig lächelnd entgegen. Ohne Zweifel: Er ist der gute Amerikaner, der das Beste für seine Familie, für "God's own country", ja für die ganze Welt will. Aber irgendwo in diesen Augen und hinter jeder Zeile dieses Buches lauert ein bösartiger Uncle Sam, der uns mit irrem Blick anstarrt, weil er uns alle, mit Haut und Haaren, haben will.
Das wäre der Amerikaner, den King in seinen besten Horror-Romanen zur Tat schreiten läßt und dessen schreckliche Gestalt wir dort genießen, weil sie in Kings Plot wie durch ein Korsett perfekt geformt und zugleich wie in einer Zwangsjacke fixiert ist. Wer die ganze flackernde Blauäugigkeit von Kings erstem nichtfiktionalen Buch ermessen will, wer in den amerikanischen Abgrund hinter dreihundert Seiten amerikanischer Flachheit blicken möchte, sollte sich vorher eine Nacht mit einem King-Roman, mit "Friedhof der Kuscheltiere", Shining" oder "Stark", um die europäischen Ohren schlagen.
Stephen King: "Das Leben und das Schreiben". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Andrea Fischer. Ullstein Verlag, Berlin 2000. 333 S., geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main