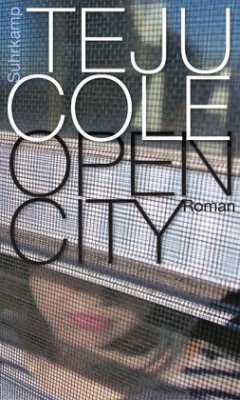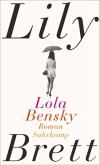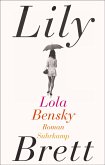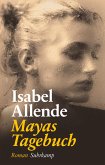Julius, ein junger Psychiater, durchstreift die Straßen Manhattans, allein und ohne Ziel, stundenlang. Die Bewegung ist ein Ausgleich zur Arbeit, sie strukturiert seine Abende, seine Gedanken. Er lässt sich treiben, und während seine Schritte ihn tragen, denkt er an seine kürzlich zerbrochene Liebesbeziehung, seine Kindheit, seine Isolation in dieser Metropole voller Menschen. Fast unmerklich verzaubert sein Blick die Umgebung, die Stadt blättert sich vor ihm auf, offenbart die Spuren der Menschen, die früher hier lebten. Mit jeder Begegnung, jeder neuen Entdeckung gerät Julius tiefer hinein in die verborgene Gegenwart New Yorks - und schließlich in seine eigene, ihm fremd gewordene Vergangenheit.
Für seinen faszinierenden Roman über einen Flaneur des 21. Jahrhunderts ist Teju Cole mit Autoren wie Sebald, Camus oder Naipaul verglichen worden. Getragen vom Fluss seiner bewegenden, klaren Sprache, erzählt "Open City" eine Geschichte von Erinnerung, Entwurzelung und der erlösenden Kraft der Kunst.
Für seinen faszinierenden Roman über einen Flaneur des 21. Jahrhunderts ist Teju Cole mit Autoren wie Sebald, Camus oder Naipaul verglichen worden. Getragen vom Fluss seiner bewegenden, klaren Sprache, erzählt "Open City" eine Geschichte von Erinnerung, Entwurzelung und der erlösenden Kraft der Kunst.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit viel Lob bespricht Rezensent Oliver Jungen Teju Coles Debütroman "Open City", der ihm als einer der "elegantesten Prosa-Essays" über das Zusammenwirken von Identität und Erinnerung seit W. G. Sebald erscheint. Er folgt hier einem jungen amerikanischen, einsamen Psychiater mit afrikanischen Wurzeln bei seinen Streifzügen durch das fremdenfeindliche Brüssel und das fremdenfreundliche New York - dabei nach "Benjamin-Art" über Kosmopolitismus und Multikulturalismus räsonierend. Der Kritiker erlebt hier nicht nur, wie in New York etwa Schwarze von Schwarzen überfallen werden und ein Weißer einer Asiatin Chinesisch beibringt, während in Brüssel etwa zwei gebildete Marokkaner ihren Israel-Hass und ihre Al-Quaida-Sympathien als Heiligen Krieg im Namen der Differenz darstellen, sondern auch wie Coles melancholischer Protagonist vergeblich versucht, der Auseinandersetzung mit der eigenen Doppelidentität durch die protokollierende Beobachterperspektive zu entfliehen. Abgesehen von wenigen "debütantenüberdeutlichen" Bildern kann der Kritiker diesen herausragenden, schönen und zugleich "beunruhigenden" Flaneur-Roman nur unbedingt empfehlen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Kosmopolitismus als Syndrom, Bildung als Panzer: Teju Coles fulminanter Flaneur-Roman über New York und Brüssel
Ist die Psychiatrie "heute auf demselben primitiven Entwicklungsstand wie die Chirurgie zu Paracelsus' Zeiten"? Das fragt sich mit Julius, dem Helden von Teju Coles Großstadtroman "Open City", ein junger Psychiater. Wie in der frühneuzeitlichen Signaturenlehre schließe man in seiner Profession von äußeren Zeichen auf innere Vorgänge. Erschwerend komme hinzu, dass "die Quelle unseres Wissens über das Bewusstsein des Patienten dessen Bewusstsein selbst ist" - und somit alle psychologische Behandlung ein "großer blinder Fleck". Mit diesem Selbstzweifel gibt sich Julius als postmoderner Intellektueller zu erkennen, der französischen Antipsychiatrie zuneigend. Die Probleme treten freilich erst beim Stellen der Diagnose auf, nicht schon beim möglichst wertungsfreien Observieren.
Und so nähert sich Julius seiner wichtigsten Patientin einfach protokollierend, liest die Zeichen, aber belässt ihnen die Mehrdeutigkeit. Diese Patientin ist kein Mensch, sondern ein Konstrukt, und zwar eines aus der Praxis (dessen Theorie, der Postkolonialismus, hinterherstolpert): Es ist der nach allen Ver- und Entmischungskriegen übrig gebliebene Kosmopolitismus der Metropolen. Die offene Stadt tritt hier zweifach in Erscheinung, im alteuropäischen Gewand das xenophobe Brüssel und als nervöser Weltgeistschmelztiegel unserer Tage das xenophile New York. Beide Orte durchstreift unser Flaneur, dabei nach Benjamin-Art räsonierend.
Über weite Strecken besteht das ruhige, schöne und zugleich beunruhigende Buch aus diesen Spaziergängen des westlich gebildeten, aber doch auch seine afrikanischen Yoruba-Wurzeln zumindest versuchsweise würdigenden, sogar hier und da die afroamerikanische "Brother"-Verbrüderungsrhetorik einsetzenden Helden. Als Kind einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters personifiziert er den postkolonialen Multikulturalismus geradezu: "Original und Spiegelung in einem". Ohne Familie steht er da, seine Freundin hat ihn verlassen, und mit Professor Saito verliert er seinen Mentor. Der melancholische Grundton scheint mit dieser Einsamkeit des Protagonisten zu tun zu haben, der als Hybrid in beiden Kulturen schräg angesehen wird.
Wir erkennen das seinerseits hybride New York von heute, in dem es keine Schichten mehr gibt, nur Zonen. Wir beobachten einen Weißen, der einer Asiatin Chinesisch beibringt, besuchen einen haitianischen Schuhputzer, der sich als freigekaufter moderner Sklave entpuppt, jedoch die Familie, in der er diente, als seine eigene bezeichnet und en passant eine Theorie der Gesellschaft als Flechtwerk entwirft: "Der Kopf ist nicht bedeutender als der Fuß." Die größte Bedrohung New Yorks ist ebenfalls klassenübergreifend, nämlich der Angriff quasi unbesiegbarer Bettwanzen. Dass Hautfarbe, obwohl allseits bemerkt, viel an sozialer Prägekraft eingebüßt hat, zeigt sich negativ daran, dass der Held von zwei Schwarzen überfallen wird.
Ethnische Großsolidarisierungen findet man eher noch in Europa, in diesem Fall in Brüssel. Dort entblöden sich zwei hochgebildete Marokkaner nicht, ihren blinden Israel-Hass bis hin zu Al-Qaida-Sympathien als Heiligen Krieg im Namen der Differenz zu verkaufen: das Gegenstück zum Nationalismus und leider sehr authentisch.
Immer mehr verliert sich der entscheidungsschwache Protagonist selbst. Er treibt dahin. Er vergisst die Geheimzahl seiner Bankkarte und fühlt sich hilflos. Der Leser muss sich eingestehen, dass ihm der Held trotz aller vorauseilenden Identifikation fremd bleibt. Was von Umweltschutz bis zu sozialen Bewegungen andere Linksintellektuelle verbindet, interessiert Julius nicht. "Kein Anliegen zu haben", hält er für Radikalisierungsprophylaxe. Doch kaum hat man sich damit abgefunden, dass die Hauptfigur eine reine Beobachterinstanz darstellt, das Offene schlechthin, wird eben das als Selbsttäuschung entlarvt: Eine alte, verdrängte Schuld des Helden scheint auf und wird begleitet von einer Reflexion darüber, dass wir uns nie "als die Bösewichte unserer eigenen Geschichte wahrnehmen". All das assoziative Erinnern an geschichtliche und künstlerische Details war aktives Vergessen. Aber was da in der Spalte zwischen der eigenen Doppelidentität verschwinden und gebildet überschrieben werden sollte, drängt doch nach oben.
Der Bewunderer Gustav Mahlers, "Genie des anhaltenden Abschieds" genannt, befindet sich selbst im Interim zwischen Absprung und Aufschlag: ein dreihundert Seiten anhaltender Abschied von der Illusion der Unschuld. Hier endet die Mehrdeutigkeit. Schließlich sehen wir ihn in einem Kahn auf dem Styx, Charon bietet Champagner an, und vorn grüßt die Freiheitsstatue des Jenseits, ein wenig debütantenüberdeutlich, mag sein. Gleichwohl handelt es sich bei diesem Roman mit Migrationsvordergrund um einen der elegantesten Prosa-Essays über das komplexe Zusammenspiel von Identität und Erinnerung seit W. G. Sebald.
OLIVER JUNGEN
Teju Cole: "Open City". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Christine Richter-Nilsson. Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 335 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Jung, schwarz, brillant: Teju Cole hat einen Roman über das Grundgefühl von New York geschrieben und wird nicht nur dort zu Recht gefeiert."
Mara Delius, WELT am SONNTAG
Mara Delius, WELT am SONNTAG