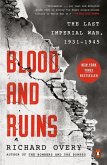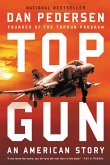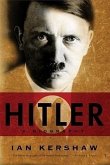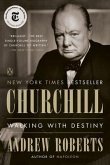Ein hochaktueller Essay über ein großes Menschheitsthema: Opfer von Krieg und Gewalt sind in den Medien allgegenwärtig, ob als Bilder von verstümmelten Soldaten, von verängstigten Kindern oder leidenden Zivilisten. Doch wer gilt eigentlich wann und warum als Opfer? Die Historikerin Svenja Goltermann erzählt, wie das Bild des Opfers, das wir heute kennen, sich erst seit dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat: Mit den modernen Gesellschaften entstand das Bedürfnis, die Verluste zu zählen und die Toten zu identifizieren. Zugleich sollte der Krieg humanisiert, Kriegsversehrte sollten versorgt, Überlebende und Hinterbliebene entschädigt werden. So wurde der Begriff des Opfers nach und nach ausgeweitet, von Soldaten auf die zivile Bevölkerung, von körperlichen Verletzungen bis zur Anerkennung des Traumas als seelische Wunde.Wer jedoch als Opfer überhaupt benannt und anerkannt wird, war und ist eine Frage von Hierarchien und Macht - und damit ein eminent politisches Problem.Nominiert für den Bayerischen Buchpreis 2018.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
ein Musterbeispiel an Gelehrtheit und Sachkundigkeit. Die Presse 201803

Wir erkennen heute "Opfer", wo frühere Generationen nicht auf die Idee kamen, dieses Wort zu verwenden: Svenja Goltermann erklärt, welche Rolle Recht und Medizin dabei spielten.
Opfer" zu sein ist ein sehr ambivalenter Status. Im Wort klingt die Erfahrung von einer Verletzung, womöglich von erlittenem Unrecht an. Die Schwäche des Opfers kann Reaktionen von Mitleid und Herabsetzung auslösen. Auf jedem Pausenhof verständlich ist das Schüler-Schimpfwort "Du Opfa!" Zugleich kann die Opferposition aber auch Rechte begründen: Opfer können moralisch, politisch und juristisch in sehr machtvollen Stellungen sein, sie können - wie die Terroropfer vom Breitscheidplatz - Forderungen stellen. Manchem sind sie gerade deswegen suspekt. Die Züricher Historikerin Svenja Goltermann hat ein faszinierendes Buch geschrieben, das diesen Aufstieg des Opfers erklärt und schließlich als politischen Fortschritt verteidigt.
Erstaunlicherweise ist es eine jüngere Entwicklung, in so vielen und verschiedenen Zusammenhängen von "Opfern" zu reden: "Kriegsopfer" und Opfer von Gewalt bilden die wichtigsten Gruppen. Zu Recht macht Goltermann immer wieder auf diese historische Wahrnehmungsverschiebung aufmerksam: Wir erkennen heute "Opfer", wo frühere Generationen kaum auf die Idee gekommen wären, dieses Wort zu verwenden. Politiker, Journalisten und Wissenschaftler sahen nur Tote, Vermisste oder Verletzte. Goltermann bringt sehr plausible Belege für den quantitativen Aufstieg in der Sprache. Womöglich hätten hier aber die "digital humanities" und speziell die "Distant Reading"-Methode des italienischen Literaturwissenschaftlers Franco Moretti noch präzisere Befunde geliefert.
Den roten Faden des Buches bilden Dokumente und Diskurse zu den Gewalt- und Leidenserfahrungen des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. Goltermann erinnert in ihrer Einleitung daran, dass es keinen Deutungsautomatismus gibt, wie Menschen solche extremen Erfahrungen interpretieren. Dies gilt gerade auch für die Auswirkungen von Kriegsgewalt. Aber auch in zivilen Verhältnissen haben sich die Opferzuschreibungen dramatisch vermehrt. Goltermanns interessante These ist, dass überall neues juristisches und medizinisches Wissen ausschlaggebend war. Vielfach hat man den Eindruck, dass die Rede vom "Opfer" die Ausübung illegitimer Gewalt voraussetzt. Weil Letztere sich wiederum nach den Maßstäben des Rechts bemisst, könnte man die Karriere des Opfers als Produkt der Verrechtlichung unserer Lebenswelt begreifen.
Das schlanke Buch erzählt anschaulich von solchen Interpretationsveränderungen. Goltermann verbindet dabei historische Praktiken mit zeitgenössischen Theorien, ihr Schwerpunkt liegt auf Textquellen wissenschaftlicher, rechtlicher oder administrativer Natur. Gelegentlich assoziiert die Autorin Bilder oder eindrückliche Erzählungen aus Romanen oder Filmen. Zu Recht, denn beide Medien haben die Vorstellungskraft tiefgreifend geprägt.
Schon Goltermanns Ausführungen über den Krieg des neunzehnten Jahrhunderts verdeutlichen einen Wandel. Zunehmend interessierte sich die staatliche Verwaltung für den im Ausland verstorbenen Soldaten. Regierungen versuchten, über den Verbleib ihrer Soldaten Rechenschaft abzulegen und Leichen zu identifizieren. Die Erfassung der Toten und der Todesursachen war wichtig für das Militärversorgungs- und Fürsorgewesen. Preußen führte 1870 die Identifizierungsmarke für Soldaten ein. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war es bereits die Norm, dass ein toter Soldat namentlich identifiziert werden musste. Kaum zu unterschätzen ist dabei die normierende Rolle des Völkerrechts in seinen Bestrebungen, den Krieg zu "zivilisieren". Hier wurden neue Standards der Kriegführung verabredet, die legitime von illegitimer Gewaltausübung trennten. Eine solche erschien nun als "Hinschlachten Wehrloser", als Barbarei, und sie erleichterte die Zuschreibung als passives "Opfer". Die Redeweise von "Opfern" beschwor - in oft diffuser Weise - die Schuld und Verantwortung von "Tätern". Zugleich kam die Zivilbevölkerung in den Blick der Theoretiker des Kriegsrechts wie der Aktivisten vom Roten Kreuz. Eine Ausweitung von Opferzuschreibungen wurde in Gang gesetzt, die sich im Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts beschleunigte.
Ursächlich dafür war der Ausbau des Sozialstaates mit seinen Versorgungsleistungen und -ansprüchen. Versehrte Soldaten konnten Rentenanträge stellen. Die Erwartung, die damit verknüpft war, ging auf Anerkennung ihres Opfers im Krieg für die Nation. Besser als in ihren Passagen über das neunzehnte Jahrhundert gelingt Goltermann hier für die Zwischenkriegszeit eine überzeugende Verbindung von politisch-militärischen Vorgängen und dem Wandel in der Sprache. Die Nationalsozialisten verherrlichten nicht nur das Opfer, sondern auch wieder den Krieg als solchen. Hier schien nochmals ein Opferverständnis auf, das besondere Nähe zur Figur des religiös-politischen Märtyrers hatte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland eine Heroisierung des soldatischen Opfers diskreditiert. Anders die Sichtweise der Sieger: die Sowjetunion sprach offiziell nur von "Helden" (über die außereuropäische Welt erfährt man in diesem Abschnitt wie auch sonst leider zu wenig). Auch im zivilen Leben blieben die Verhältnisse schwierig. Immer noch war es aber in Europa und den Vereinigten Staaten keineswegs moralisch vorteilhaft, sich als "Opfer" zu bezeichnen.
Es gehört zu den interessantesten Passagen des Buches, wenn Goltermann nachzeichnet, wie sich in den Jahrzehnten nach 1945 die Figur des passiven, unschuldigen Opfers in der kollektiven Wahrnehmung durchsetzte. Zuvor dominierten Zuschreibungen einer wie auch immer gearteten Mitschuld das moralische Feld. In geradezu schockierender Weise wurde manchen Verbrechensopfern automatisch Minderwertigkeiten, Verfehlungen und Makel zugeschrieben, und manches davon hat sich bis heute gehalten.
Dass Verbrechensopfer Entschädigungen beantragen können, liegt erst wenige Jahrzehnte zurück. Heute ist die Opferentschädigung immer dort, wo sie eingeführt wird, ein heißes politisches Eisen. Nach Kriegen und Diktaturen sind die Nöte groß, und entsprechend haben die Kriege in Vietnam und zuletzt Jugoslawien auch unsere Vorstellungen über Opfer, Traumata und Opferrechte medizinisch, moralisch und juristisch gewandelt. Dass Opfer zudem oft unbequeme Mitmenschen sind, ja manchmal zugleich Täter sein können, kommt in dem Buch leider zu kurz.
Neuerdings weht heute jenen, die sich als Opfer bezeichnen, wieder ein kalter Wind ins Gesicht. Die Ausweitung des Opfer-Begriffs mag schon ihren Zenit überschritten haben, mutmaßt Goltermann. Deutlicher als zuvor tritt die Schwäche des Opfers hervor, die als Unfähigkeit interpretiert wird. In rauhen Zeiten wird stattdessen einseitig "Resilienz" gepredigt, die Fähigkeit, Belastungen zu überwinden. Die Autorin erinnert uns hingegen, dass der Opfer-Begriff "die Möglichkeit bereithielt, Kritik an Unrecht und Gewalt zu äußern". Opfer anzuerkennen ist ein notwendiger Luxus, den sich alle Gesellschaften leisten sollten. Wie man gesellschaftliche Narrative von Opfern gestalten kann, ohne zugleich Inferiorität der Betroffenen zu postulieren, bleibt eine Herausforderung.
MILOS VEC.
Svenja Goltermann: "Opfer". Die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017. 333 S., geb., 23,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Gottlieb F. Höbli lernt die problematische Geschichte des Begriffs "Opfer" kennen in diesem Buch der Historikerin Svenja Goltermann. Anhand von Einblicken in Medizin, Kriegs- und humanitäres Völkerrecht kann ihm die Autorin anschaulich und faktengesättigt vermitteln, wie sich durch eine veränderte Wahrnehmung von Krieg und Gewalt der Begriff vom "Krüppel zum Kriegsopfer" wandelte und soldatische Opfer in Folge Anerkennung statt Mitleid verlangten. Interessiert liest der Kritiker hier auch nach, wie mit den US-amerikanischen Heimkehrern aus dem Korea- und Vietnamkrieg auch die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung aufgenommen wurde. Und auch wenn Höbli Goltermanns Einwänden zur Kritik an einer gegenwärtigen "Opferkultur" und einer "Konjunktur des Opfers" nicht anschließen möchte, kann er die Lektüre dieser lehrreichen Studie unbedingt empfehlen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH