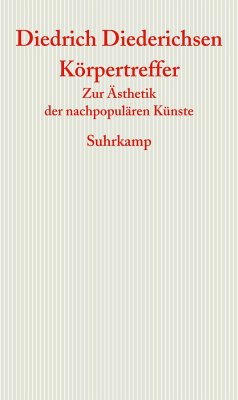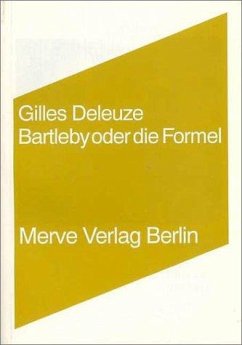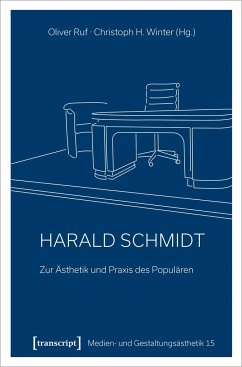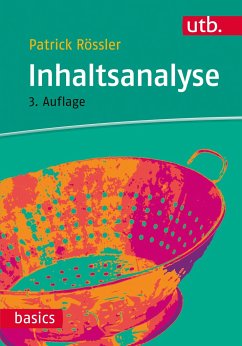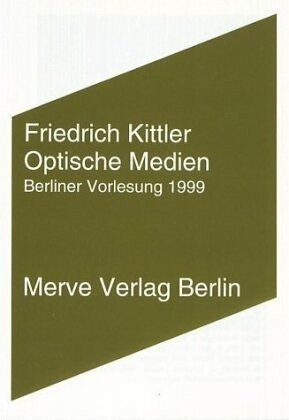
Optische Medien
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Friedrich Kittlers Vorlesung liefert eine konzise Geschichte der optischen Medien, die von der Camera obscura und Albertis Linearperspektive bis zu neuesten Entwicklungen der Fernsehtechnik und Computergraphik reicht. Es geht um Künste und Techniken als zwei sehr unterschiedlichen Weisen, die Grenzen der Sichtbarkeit zu verschieben; aber auch um die Effekte, die die Entwicklung des Films auf das uralte Speichermonopol der Schrift gehabt hat. Kurz, eine medienhistorische Einführung in die technischen Aprioris der Bildproduktion.