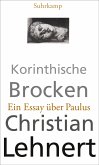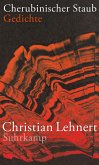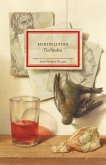Im Flechtwerk, Lehnerts achter Gedichtband, ist ein streng gefügtes Werk. Siebenmal sieben Gedichtpaare bilden ein Flechtwerk, eine verwobene Kunst der Fuge. Musikalische Strukturen prägen den Zyklus: von Reimklängen bis zur Motivverarbeitung in verschränkten Zusammenhängen nach dem Vorbild barocker Kantaten.
Doch geht es nicht um formalistische Exerzitien. In ihrer so expressiven wie reflexiven Musikalität erkunden Lehnerts Gedichte die Natur, indem sie ihr antworten. Und mehr noch: Gegen den als Anthropozän maskierten Totalzugriff des Menschen auf seine Umwelt suchen die Gedichte ein Widerlager. Im Übergang zwischen Denken und Wahrnehmung spüren sie dem Geistigen nach: In dem, was »Materie« scheint, erfahren sie Offenbarung in Pflanzen, Tieren und Dingen, in Tageszeiten und im Spiel der Wellen.
Doch geht es nicht um formalistische Exerzitien. In ihrer so expressiven wie reflexiven Musikalität erkunden Lehnerts Gedichte die Natur, indem sie ihr antworten. Und mehr noch: Gegen den als Anthropozän maskierten Totalzugriff des Menschen auf seine Umwelt suchen die Gedichte ein Widerlager. Im Übergang zwischen Denken und Wahrnehmung spüren sie dem Geistigen nach: In dem, was »Materie« scheint, erfahren sie Offenbarung in Pflanzen, Tieren und Dingen, in Tageszeiten und im Spiel der Wellen.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Jörg Magenau spürt das Musikalische und die Formstrenge in Christian Lehnerts Gedichten. Der "hymnische Naturdichter" mit einem dichterischen Selbstverständnis als Gottesdienst-Leister hat es Magenau angetan. Wenn der Autor sich mit Zitaten von Böhme und Meister Eckhart in die Tradition der Mystiker einschreibt, erkennt Magenau noch immer genug Weltliches in den Texten. Der Autor wendet sich nicht dem Transzendenten zu, sondern der Natur mit Haselnuss und Stockrose und Glühwurm, erklärt Magenau.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Darf man so schön dichten wie Christian Lehnert?
Ein Buch, das in diesem dunklen Frühjahr 2022 erscheint, wurde natürlich schon lange Monate früher geschrieben. Aber wir lesen es jetzt. Wir hören täglich von toten Menschen, ausgebombten Häusern, zerstörten Straßen, verkohlten Baumstümpfen. Und dann lesen wir Gedichte auf die Vogelbeere, das Abendpfauenauge, die Samenkapsel der Stockrose und den Winterwald, und alles, wie es die einleitende Inschrift sagt: "Soli Deo Gloria." Gedichte zum Ruhm Gottes, geht das? Geht das heute?
Der 1969 in Dresden geborene Christian Lehnert ist ein Solitär. Theologe und Dichter, bringt er seit mehr als zwanzig Jahren in einem beeindruckenden Werk etwas zusammen, was die moderne, die heutige Poesie längst schon getrennt hat. Doch bedenkt man, dass auch Eichendorff das unvergängliche "Es war, als hätt der Himmel / die Erde still geküßt . . ." unter seine "Geistlichen Gedichte" einreihte, dann steht dieser Zeitgenosse in einer viel größeren, älteren Tradition, die unter Religiosität keineswegs einfach das Kirchenlied verstand. Von nichts ist dieser schmale Band weiter entfernt, und mit seinen Mottos geht er sogar noch tiefer zurück, zur mystischen Tradition von Jacob Böhme, Meister Eckhart, zum jüdischen Buch Sohar.
"Opus 8. Im Flechtwerk", der Titel sagt es, ist Lehnerts achter Gedichtband, und er bestätigt eine weitere Besonderheit: Jeder - von "Der gefesselte Sänger", "Ich werde sehen, schweigen und hören" bis "Cherubinischer Staub" - war ein in sich komponierter, geschlossener Zyklus, mit dem der Dichter jeweils etwas Neues begann; jeder war individuell im Aufbau, in den Formen. Noch mehr als zuvor gilt das für "Opus 8" und seine meist zweizeiligen spruchähnlichen Naturbilder im konsequent durchgeführten Wechsel mit eher traditionellen Gestalten des Gedichts. "Die Weihe öffnet sich dem Sturm / fast ohne Regung // In Böen steigt sie auf und ruht in der Bewegung", das eröffnende Bild einer Baumkrone, in der Ruhe und Sturm fast das Gleiche sind, zeigt schon eine überaus genaue Beobachtungsgabe, imstande, das Wesentliche, Charakteristische einer Naturerscheinung zu verdichten. Hier die ganz eigene Art, wie die Wiesenweihe den Wind aufnimmt und verwandelt in einen wellenförmig schwingenden Rhythmus, dort "Ein Windlaut / tiefer Ton", unter dem die Eiche "schwankt und zittert / dröhnt".
Lehnerts Gedichte sind aber durchaus kein Impressionismus in Worten. Was im Zitat klingen kann wie hingetupft, ist einem sehr streng gefügten Formprinzip unterworfen: Sieben Kapitel, bestehend aus jeweils sieben einander antwortenden Gedichtpaaren, bilden das "Flechtwerk" des Untertitels, Struktur eines Ganzen, das nichts Zufälliges hat: Jedes Gedicht steht für sich, soll aber zugleich Teil sein in einer fast musikalischen Gesamtstruktur aus Frage und Antwort, Gleichklang und Kontrast, wechselnden Tonarten und Wiederaufnahme von Themen und Motiven.
Schon lange greift Lehnert zurück auf die beiden klassischen Stilmittel Versmaß und Reim, und so auch hier. Gerade der unzeitgemäße Reim vermag es, die Beobachtungen, die Zeichnung von Blumen, Blüten, kleinen Tieren zusammenzufügen zur geschlossenen Sentenz; gewiss ein heikles Unterfangen, das aber gelingt, weil die oft auch ungewöhnlichen Reime fast ausnahmslos auf starke, sowohl syntaktisch als auch sinnlich betonte Schlussworte fallen. So schön er ist, dieser Reim ist kein Klangspiel, sondern ein ganz bewusst hervorhebendes, strukturierendes Element des Sinns, wie hier im "Abendpfauenauge": "Ein dunkles Sonnenlicht / die Glut ist rot entfacht. // Zwei Augen öffnen sich / dort wächst im Blick die Nacht." Obwohl jedes dieser Bilder nur durch menschliche Mittel entsteht, durch überlegt eingesetzte rhythmische, klangliche Eigenschaften der Sprache, ist nichts vermenschlicht; im Gegenteil, durch die große sprachliche Schönheit verwandelt sich der erst im Dunkeln leuchtende Nachtfalter in eine anziehende oder auch irritierende Rätselfigur.
Ist das zu schön? "In unserer Finsternis gibt es nicht einen Platz für die Schönheit, der ganze Platz ist für die Schönheit", schrieb René Char mitten im Krieg unter der deutschen Besatzung. Das Dogma, der modernen "Zerrissenheit" müsse ein Gedicht durch Sprengung klassischer Form entsprechen, ist lange schon dahin. Doch gerade vor diesem Hintergrund zeigen Lehnerts Gedichte noch etwas anderes. Heute, da der Mensch auf dem Weg ist zum völligen Zugriff auf die Natur, entsteht hier ein ganz eigenes Bild; die Natur ist kein Rohstoff, kein Naherholungsgebiet, sie ist seltsam, zuweilen fremd, befremdend. Jede Weißtanne, jede Königskerze steht für sich, und wo der Mensch im "Winterwald" doch genannt ist: "Ein Streif am Hang / der kahle Lärchenschlag // Ein schwarzer Strich auf einem weißen Feld // Ich schloß die Augen / und es wurde hell", wo sogar das Ich des Dichters kurz einmal auftaucht, da erscheint es nur ganz leicht am Rande, ein Schatten im Vorübergehen. Und der Gott, dessen "Ruhm" der ganze Zyklus gewidmet ist? Anders als in früheren Büchern wird er in diesen Versen gar nicht mehr genannt, und der Verzicht auf jede ausdrückliche Beschwörung macht ihre Leuchtkraft nur noch stärker.
Geht das? Der Zweifel an dem verwüstenden Weltlauf ist diesen Gedichten aus einer Welt beinahe ohne Menschen fest und verstörend eingeschrieben. Doch wird nicht auch gerade im Augenblick von Krieg und Vernichtung die Frage noch dringender, was es eigentlich ist, das bewahrt werden muss, erkämpft, verteidigt? Die Antwort auf Krieg kann jetzt nichts anderes sein als Krieg. Dennoch, beim Lesen dieser nur auf den ersten Blick so kleinen, in Wahrheit aber überhaupt nicht gegenwartsfernen Gedichte fragt man sich, ob nicht auch jede Blüte am Wegrand etwas ist wie zumindest der unscheinbare Teil einer anderen, ebenso notwendigen Antwort. WOLFGANG MATZ
Christian Lehnert: "Opus 8. Im Flechtwerk".
Suhrkamp-Verlag, Berlin 2022. 117 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Lehnerts Gedichtsammlung ist wie eine ausgestreckte Hand, die man ergreifen möchte, um dann auch anderen Menschen die Hand zu reichen.« Irmtraud Gutschke neues deutschland 20230117