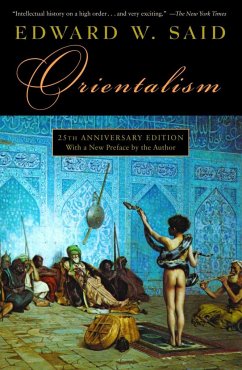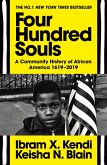A groundbreaking critique of the West's historical, cultural, and political perceptions of the East that is three decades after its first publication one of the most important books written about our divided world.
"Intellectual history on a high order ... and very exciting." The New York Times
In this wide-ranging, intellectually vigorous study, Said traces the origins of "orientalism" to the centuries-long period during which Europe dominated the Middle and Near East and, from its position of power, defined "the orient" simply as "other than" the occident. This entrenched view continues to dominate western ideas and, because it does not allow the East to represent itself, prevents true understanding.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"Intellectual history on a high order ... and very exciting." The New York Times
In this wide-ranging, intellectually vigorous study, Said traces the origins of "orientalism" to the centuries-long period during which Europe dominated the Middle and Near East and, from its position of power, defined "the orient" simply as "other than" the occident. This entrenched view continues to dominate western ideas and, because it does not allow the East to represent itself, prevents true understanding.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Einmischung in Politik, Literaturwissenschaft und Orientalistik: Edward W. Said stellte die Literatur entschlossen ins Feld der politischen Geschichte / Von Tobias Döring
Ein deutscher Soldat soll den Vater jahrelang in quälenden Albträumen heimgesucht haben. Wadie war ein arabischer selfmade man, der in Amerika sein Glück gemacht hatte und 1916 als Freiwilliger in den Weltkrieg zog. Dort habe er bei einer Aktion in Frankreich, wie er dem Sohn zu erzählen pflegte, aus nächster Nähe einen Deutschen erschossen, dessen Todesschrei ihn seither verfolgt. Die Kriegsgeschichte gehörte zum festen Erzählrepertoire in der Familie. Jahrzehnte später, nach des Vaters Tod, fanden sich die Unterlagen aus der Militärzeit, in denen allerdings vermerkt stand, daß er nie zu einer operativen Aktion mit Fronteinsatz herangezogen wurde. Dennoch, so schreibt Edward W. Said, glaube er weiterhin der Version seines Vaters; in den Papieren muß wohl ein Fehler vorgelegen haben.
Die Episode bietet eine Schlüsselszene zum Verständnis von Saids Werk. Denn sie zeigt den bemerkenswerten Glauben dieses Autors an die faktische Macht des Erzählens wie an die Kraft von Geschichten und zeugt von der Gewißheit, daß wir den Heimsuchungen der Geschichte auch dann unvermindert ausgesetzt sind, wenn ihnen Belege klar entgegenstehen. Entscheidend sind die Deutungen, die das Erlebte formen. Darin liegen sowohl Bestimmung wie auch die Chance zum Aufbruch. In dem letzten Artikel, der zu seinen Lebzeiten in der arabischen Wochenzeitschrift "Al-Ahram" erschien, schreibt er: "Die Wirklichkeit ist weder dem einzelnen (egal wie mächtig er sein mag) verfügbar, noch richtet sie sich stets nach der Eigenart einer bestimmten Gruppe. Was Menschen sind, setzt sich aus Erfahrung und Interpretation zusammen, und diese unterstehen nie vollständig der Macht: Sie sind immer auch das gemeinsame Feld von Menschen in der Geschichte."
Sein Fach, das er seit 1963 an der Columbia University in New York lehrte, war die Vergleichende Literaturwissenschaft. Seine intellektuellen Leitfiguren waren Autoren wie Joseph Conrad und Philologen wie Erich Auerbach. Said wurde zum Vordenker einer neuen Fachrichtung, der Postcolonial Studies, obwohl er diesen Begriff selbst nie gebrauchte. Seine Aufgabe fand er vielmehr darin, die Literaturen der Welt entschlossen ins Feld der politischen Geschichte zu stellen und dieses durch neue Interpretationen so zu verändern, daß es neben Albträumen auch anderen Geschichten Raum gibt.
Es versteht sich, daß die programmatische Verbindung von Philologie und Politik eine stark polarisierende Wirkung tat. Noch die zahlreichen Nachrufe auf ihn, die zu seinem Tod am 25. September letzten Jahres erschienen sind, machen deutlich, wie unterschiedlich er gesehen wird. Den einen eine Leuchtgestalt, die dem Denken neue Wege wies und im Politischen schon früh erkannte, auf welche Irrwege die Palästinenser mit Arafat geraten sind, erscheint Edward Said den anderen als Eiferer und selbsternannter Sprecher für unerbittliche Konfrontation. Manche erinnern sich an Posen wie seinen demonstrativen Steinwurf auf einen israelischen Kontrollposten im Westjordanland. Andere denken eher an den feinsinnigen Grandseigneur, der Beethovens Spätstil schätzte und gemeinsam mit Daniel Barenboim in Weimar ein israelisch-palästinensisches Jugendorchester gründete. Zuweilen fragt man sich, ob hier jeweils von derselben Person die Rede ist.
Tatsächlich sind die Gegensätzlichkeiten, die Saids Werk und Leben prägten, in vieler Hinsicht aufschlußreich. Er war palästinensischer Protestant und amerikanischer Araber, er gab sich als Verfechter Foucaults und zugleich erklärter Humanist, zeigte sich gern als Vertriebener und war doch in New York zu Hause. Schon immer war es daher leicht, ihm solche Unstimmigkeiten kritisch vorzuhalten. Der Vorwurf allerdings verkennt, daß gerade in der Unvereinbarkeit der Standpunkte wie auch der Selbstentwürfe, die Said mit kalkulierter Provokation pflegte, seine besondere Brisanz liegt. Erst daraus erklärt sich überhaupt die nachhaltige Schubkraft, die seine ausufernden Bücher - allen voran "Orientalism", sein umstrittener Bestseller von 1978 - in der Wissenschaft entfaltet haben. Nichts ist deshalb abwegiger, als ihn, wie es oft geschieht, für die Identitätspolitik einer ethnisch sortierten Literaturbetrachtung zu reklamieren oder gar als Galionsfigur der Political Correctness einzusetzen. Saids kritisches Erbe ist ein ganz anderes. Was dieser Mann gelebt und gelehrt hat, zeigt vielmehr, welche widersprüchlichen Selbsterfindungen die Konfliktgeschichten des zwanzigsten Jahrhunderts vielen Zeitgenossen abverlangen, weil deren Erfahrungswelten sich nicht länger mit vorrätigen Interpretationen decken lassen.
Dies zeigt ein Blick auf Saids Frühwerk, das heute kaum mehr diskutiert wird, obwohl dort die späteren Diskussionslinien überraschend deutlich vorgezeichnet sind. Als beispielsweise vor vier Jahren die Autobiographie "Out of Place" erschien, wurden die darin mitgeteilten Kindheitserinnerungen aus Kairo und Jerusalem sofort Gegenstand heftiger Debatten. Die öffentliche Erregung mancher Leser gipfelte darin, daß sie eigene Recherchen unternahmen mit dem Ziel, Saids Memoiren der gezielten Faktenfälschung zu überführen. Was hier in grimmen Wortgefechten um Besitz und Nutzung eines Jerusalemer Wohnhauses der Familie bestritten wurde, war die Berechtigung, als Angehöriger eines vertriebenen Volkes zu sprechen. Said reagierte denn auch mit dem Hinweis, Palästinenser hätten immer schon damit zu kämpfen, daß ihnen ihr Ort abgesprochen werde - wie es im übrigen der Titel seines Erinnerungsbandes sagt. Was aber eigentlich in Rede stand, hatte er schon mehr als drei Jahrzehnte vorher in seiner Dissertation dargestellt.
In "Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography" (1966) untersuchte er als palästinensischer Harvard-Promovend, der seit dem sechzehnten Lebensjahr in den Vereinigten Staaten lebte, wie ein polnischer Emigrant zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts die Masken und Manieren eines englischen Gentlemans literarisch annahm, um in einer spät erlernten Weltsprache die Brüchigkeit eines weitgespannten Weltreichs zu erkunden. Conrad, heißt es da, schuf sich schreibend ein brauchbares Repertoire an Posen, in denen er sich fortan präsentierte. Damit machte er sich erst den Ort, wohin ihn die Geschichte geführt hatte, und dann die Stellung, die er dort einnehmen wollte und die doch lange ungesichert blieb, behelfsmäßig zu eigen.
Allerdings enthalten Conrads autobiographische Bücher wie "A Personal Record" (1912) manche Szenen, die der Autor offenbar von seinen fiktiven Erzählerfiguren nachträglich übernahm. Doch solche Selbst-Fiktionen, erklärt Said, müssen als Sicherungsnetze oder Schutzdichtungen verstanden werden. In ihnen ist Eigenes mit Fremdem so verknüpft und Angeeignetes mit vorsätzlich Verfremdendem so durchsetzt, daß sie vom Ende jener Selbstverständlichkeit erzählen, mit denen kulturelle Zugehörigkeit vormals einherging. Eine Welt der Migration verlangt dagegen beständig Anstrengung zur Selbsterfindung.
Im Rückblick liest sich das wie eine Modellerzählung, der nicht nur Saids eigene Karriere mit ihren widersprüchlich wahrgenommenen Medienbildern detailgetreu gefolgt ist. An dieser Lesart Joseph Conrads läßt sich zugleich erkennen, was später zur zentralen Fragestellung postkolonialer Kritik werden sollte: die Frage nach dem Ort des Schreibens und des Lesens wie überhaupt dem Ort der Kultur, das heißt nach den jeweils anderen lokalen Voraussetzungen, unter denen Identitäten hervorgebracht oder zugeschrieben werden. Der große anglisierte Autor der Moderne ist dafür so maßgeblich geworden, weil er einerseits stets ganz konkrete Orte des Erzählens fingiert, andererseits seine Helden in eine albtraumhafte Fremde schickt, wo ihnen alle vormaligen Gewißheiten entgleiten. Bei Conrad wird das "Herz der Finsternis" zum mythisch überformten Ort, wo die Spurensuche nach Rückständen unserer eigenen Geschichte ins Grauen mündet. Auf der Rückseite der Zivilisation wohnt das nackte Unbehagen.
Es war Saids große und seinerzeit gewiß bahnbrechende These in "Orientalism", daß die westliche Kultur genau solche finsteren Orte immer wieder imaginieren mußte, nur um sich selbst als deren Überwinder, Bezwinger oder Erleuchter strahlend zu entwerfen. Die politische Überformung durch koloniale Unterwerfung folge nur der diskursiven in den Wissenschaften, Bildern und Erzählungen vom Fremden, und erst darin konnten solche Orte, seien sie in Afrika oder in Asien lokalisiert, überhaupt in die Geschichte eingehen. Vor der Entdeckung durch Europa nämlich wurde ihnen alle historische Dynamik abgesprochen. Genau dagegen richtete sich in der Tat der vehemente Einspruch all jener afrikanischen oder asiatischen Autoren, die, im kolonialen Bildungssystem groß geworden, zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts feststellten, welche Rollen dieses ihnen zuwies. Sie hatten Conrad und weitere europäische Selbstverständigungstexte am anderen Ort gelesen und bemerkt, daß ihrer Lebenswirklichkeit darin kein Raum zugebilligt wurde. Was daher als postkoloniale Literaturen bekannt wurde, wollte zuallererst die Kulisse jener sprachlosen, geschichtslosen exotischen Welt durchbrechen, in der so viele alte Abenteuer spielen.
So kam es im Zusammenspiel von Saids Thesen mit den neuen Literaturen zu der politischen Wirkungsmacht, die bald an amerikanischen wie auch europäischen Universitäten Leselisten umstürzte und den Kulturkampf ausrief. Doch recht besehen, lag Said nichts ferner, als etwa den westlichen Kanon zu verabschieden und hinfort nur noch vermeintliche Minoritätenliteratur zum Studium zuzulassen. Vielmehr geht es ihm um die ungleich spannendere, weil kritischere Frage, was für Zugangsweisen zu den großen alten Texten möglich sind, die deren weltlich-politische Dimension aus heutiger Sicht und in jeweils veränderter lokaler Perspektive neu ermessen. Statt um andere Bücher geht es also um andere Lesarten, die wir brauchen. In "Culture and Imperialism" (1993), seinem zweiten Hauptwerk, führt er zur Erläuterung ein musikalisches Verfahren an. "Kontrapunktische Lektüre" nennt Said seine Methode, die den Leitmotiven und kanonischen Stimmen der Weltliteratur Gegenstimmen hinzufügt und damit anderen Seiten der Geschichte Gehör verschafft. Der neue Kontrapunkt aber bildet mit dem Überlieferten eine übergreifende, polyphone Werkeinheit. Die postkoloniale Lektüre bleibt in der Partitur der Kanons.
Es trifft sich, daß das Werk des jüngsten südafrikanischen Literaturnobelpreisträgers ein sehr instruktives Beispiel dafür bietet. J. M. Coetzees Roman "Foe" (1986), deutsch unter dem Titel "Mr. Cruso, Mrs. Barton und Mr. Foe" erschienen, erzählt die klassische Fabel von "Robinson Crusoe", einem Manifest der bürgerlichen Selbsterfindung, neu, indem er ihr eine neue Stimme und Figur hinzufügt. Hier ist es eine Frau, die, ebenfalls als Schiffbrüchige, zu Robinson und Friday auf die Tropeninsel kommt und deren Geschichte nach der Rettung einem englischen Romanautor vermittelt. Die uns von Defoe bekannte zivilisatorische Erfolgsstory wird hier nur noch schemenhaft wie auf Phantombildern kenntlich, während Coetzees Erzählerin mit dem Berufsschriftsteller um die treffende Darstellung des Erinnerten streitet. Doch diese Phantome zeigen, wie die koloniale Selbstgewißheit des frühen achtzehnten Jahrhunderts zum Ende des zwanzigsten noch als Gegenbild aktueller Konflikte - ob in Südafrika oder andernorts - weiterwirkt.
Auch Edward Saids kritisches Erbe läßt sich so verstehen. Statt sich von Weltliteratur zu verabschieden, hat er diesem Begriff seine wörtliche Bedeutung wiedergegeben: als Literatur von und in der Welt. Wir müssen uns, so lehrt sein Werk, alles Literarische immer auch als weltliches Ereignis vorstellen und danach fragen, welche Voraussetzungen und Folgen das Erzählte in der Wirklichkeit verlangt. Auch dies kann Said wohl von Conrad gelernt haben, für den Bedeutung nie im Kern, sondern stets im Umkreis einer Geschichte lokalisiert war und der einmal schrieb, ein gutes Buch sei eine gute Tat. Doch zur eigentlichen Leitfigur, um die Welthaltigkeit allen Erzählens zu erkunden, wählte Said sich Erich Auerbach.
Die Wahl mag überraschen, wenn man diesen großen deutsch-jüdischen Philologen vor allem als Verfechter jener "abendländischen" Kultur versteht, der Said doch ihre "orientalistischen" Projektionen vorhielt. Allerdings sieht Said ihn in erster Linie ebenfalls als Emigrant und liest sein Werk ganz im Hinblick auf den historischen wie geographischen Ort, von dem es ausgegangen ist. "Mimesis", Auerbachs erstmals 1946 erschienene, große Erzählung über Wirklichkeitsdarstellung in der Literatur von Homer bis Virginia Woolf, entstand in Istanbul, wohin er während des Weltkriegs geflohen war. Wie Said in "The World, the Text and the Critic" (1983) ausführt, ist die Exilerfahrung konstitutiv. Auerbach hat keine brauchbare Bibliothek zur Verfügung, kein Archiv der Forschung und Erinnerung; ringsum bricht die Welt in Trümmer. Daher entwirft er einen behelfsmäßigen Gedächtnisraum, indem er die großen Texte der Weltliteratur zur Wirklichkeitsbestimmung aufruft. Dem westlichen Kanon unterliegt so der Phantomschmerz des Verlorenen.
In ebendieser Weise unternahm Said es konsequent, der Literaturwissenschaft die Verlustrechnung aufzumachen. Von Marx borgte er die Geste des großen Umkehrers, der die Theorien vom Kopf auf die Füße stellt und ihnen Beine macht. Von Foucault übernahm er Einsichten in den Zusammenhang von Autorschaft, Autorität und Macht, von den Poststrukturalisten manche Behauptung über die totale Vertextung der Welt. Doch all dies nutzte Said nur für ein Verfahren, das er "säkulare Kritik" nannte und das ganz auf weltliche Effekte ausgerichtet war. Es stellt die Frage nach den Ortsbestimmungen, die mit Texten vorgenommen werden und sich mit deren neuen Deutungen immerfort verschieben. "Kritik" in diesem Sinn ist immer lebenspraktisch und politisch ausgerichtet, ohne sich doch notwendig einem bestimmten Programm zu verschreiben. Sie setzt auf den grundsätzlichen Ereignischarakter, mit dem jeder Akt des Lesens wie des Schreibens wirksam wird.
So zeigt sich, daß Edward Said seinem großen Antipoden Harold Bloom in vielem sehr viel näher steht, als es in Jahren bitterer Auseinandersetzung lange Zeit schien. Denn beide messen dem Literarischen letztlich einen Rang zu, der es zur Leitinstanz der Lebenswelt befähigt. Zwar hat Said sich, anders als Bloom, dazu nie im Bollwerk eines geheiligten Traditionskanons verschanzt, sondern vielmehr dessen Umbau eingefordert und befördert. Aber sein beharrliches Eintreten für die Orientierungsmacht des Erzählens war klar von dem Glauben getragen, daß Bücher schlicht bedeutsam sind, weil ihre Geschichten die Welt verändern können. In diesem Sinn ist Saids kritisches Erbe konservativ, ja restaurativ zu nennen, denn den Prämissen postmoderner Literaturtheorien will es sich entschieden widersetzen.
Bei aller Brillanz der Formulierung sind es daher schlichte Thesen, mit denen Said die größte Wirkung tat. Tatsächlich war er sehr darauf bedacht, durchweg den Gestus eines Amateurs zu pflegen, der sich in Dinge einmischt, die er im Grunde nicht versteht. Sei es in der Nahost-Politik, in der Literaturwissenschaft oder der Orientalistik - immer war ihm die Position des Außenseiters zweckdienlich, um gegen die Expertenkultur Einspruch zu erheben und an grundständige Belange zu erinnern. Sein Auftreten war oft geprägt vom pädagogischen Furor des großen Aufklärers, der auch vor großen Vereinfachungen nicht zurückscheut. Sein Gestus hat viel von Ludovico Settembrini, dem Humanisten in Thomas Manns "Der Zauberberg", der überall, wo er Verdunkelung am Werk sieht, sogleich das Licht einschaltet. Und ganz wie Settembrini hat auch Said der Institution der Medienmacht, der Universität oder der sonstigen intellektuellen Sanatorien, gegen die er unermüdlich wetterte, selbst auf Dauer angehört.
Zum Ende der Autobiographie findet sich eine Episode, die Said selbst als Schlüsselmoment seiner Laufbahn deutet. Auf dem College in Neuengland stellt der Englischlehrer ein banales Aufsatzthema: "Über das Streichholzanzünden". Schüler Edward liest gehörig, was in Enzyklopädien und Chemie-Lehrbüchern steht, und reicht seinen Aufsatz ein. Nach der Durchsicht fragt der Lehrer, ob dies wohl die beste Art sei zu beschreiben, was mit Streichhölzern zu tun ist: "Was ist, wenn jemand damit einen Wald anzündet oder eine Kerze in einer dunklen Höhle oder, im übertragenen Sinn, so wie Newton ein dunkles Rätsel wie die Gravitation erhellt?" Said bekennt, daß dies für ihn die Initialzündung gab, sich fortan durch eigenes Erkunden einen Ort der Zugehörigkeit zu schaffen. Was in vorfindlichen Texten steht, ist immer nur ein Teil der Welt. Anderes erhellt sich erst durch Selbstdeutung und den Gebrauch des eigenen Verstands. Und auch wenn dies beständig Reibereien mit sich bringt, brennt durch die Reibungsenergie dafür das Streichholz der Erkenntnis um so heller.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Intellectual history on a high order ... and very exciting." The New York Times
"Powerful and disturbing.... The theme is the way in which intellectual traditions are created and transmitted." The New York Review of Books
"Stimulating, elegant yet pugnacious.... Said observes the West observing the Arabs, and he does not like what he finds." The Observer
"An important book.... Never has there been as sustained and as persuasive a case against Orientalism as Said's." Jerusalem Post
"Powerful and disturbing.... The theme is the way in which intellectual traditions are created and transmitted." The New York Review of Books
"Stimulating, elegant yet pugnacious.... Said observes the West observing the Arabs, and he does not like what he finds." The Observer
"An important book.... Never has there been as sustained and as persuasive a case against Orientalism as Said's." Jerusalem Post