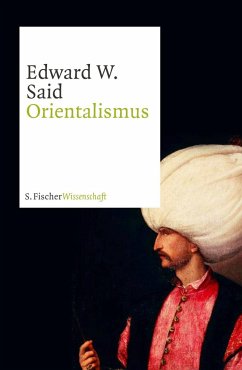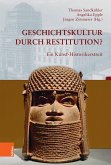Endlich: Die Neuausgabe des Klassiker in einer neuen Übersetzung. Aktueller denn je.
In seiner aufsehenerregenden Studie entlarvt Edward Said das Bild des Westens vom Orient als zutiefst einseitig und als eine Projektion, indem der »Orient« schlicht als »anders als der Okzident« verstanden wurde. Er verfolgt die Tradition dieses Missverständnisses durch die Jahrhunderte, in denen Europa den nahen und mittleren Osten dominierte, und zeigt, wie auch heute noch dieses Bild den Westen beherrscht. Weil es dem Orient dadurch verwehrt wird, sich selbst zu repräsentieren, wird ein wahres Verständnis der Kulturen verhindert. Gerade heute, dreißig Jahre nach seinem ersten Erscheinen, hat dieser Klassiker der Kulturgeschichtsschreibung nichts an Aktualität eingebüßt - ganz im Gegenteil.
In seiner aufsehenerregenden Studie entlarvt Edward Said das Bild des Westens vom Orient als zutiefst einseitig und als eine Projektion, indem der »Orient« schlicht als »anders als der Okzident« verstanden wurde. Er verfolgt die Tradition dieses Missverständnisses durch die Jahrhunderte, in denen Europa den nahen und mittleren Osten dominierte, und zeigt, wie auch heute noch dieses Bild den Westen beherrscht. Weil es dem Orient dadurch verwehrt wird, sich selbst zu repräsentieren, wird ein wahres Verständnis der Kulturen verhindert. Gerade heute, dreißig Jahre nach seinem ersten Erscheinen, hat dieser Klassiker der Kulturgeschichtsschreibung nichts an Aktualität eingebüßt - ganz im Gegenteil.

Ein Klassiker, neu übersetzt und mit wichtigen Zusätzen aktualisiert: Edward Saids Buch "Orientalismus" hat Politik und Wissenschaft in Aufruhr versetzt.
Haben westliche Orientforscher, aber auch Schriftsteller wie Flaubert oder Nerval, Dichter wie Matthew Arnold und Maler wie Ingres dazu beigetragen, den Orient erst zu schaffen und damit den Orientalen "orientalisiert" mit dem Ziel, ihn im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus leichter und besser beherrschen, sprich unterdrücken zu können? Und wenn es so war, taten sie das wissentlich oder mehr indirekt, als Angehörige einer bestimmten, eben der westlichen, seit Aischylos (Perserkriege) und Aristoteles (der zwischen Griechen und Barbaren unterschied) in ihren abgrenzenden Kategorien befangenen "westlichen" Kultur, die sich seit den Tagen des Kolumbus anschickte, in alle Erdteile auszugreifen?
Mit dieser These, dass "der Orient", wie man ihn im Westen vor Augen habe, in Wirklichkeit ein ideologisches Konstrukt namens "Orientalismus" sei, befasste sich im Jahre 1978 der in Princeton lehrende palästinensische Literaturprofessor Edward W. Said in seinem zu Berühmtheit gelangten Buch "Orientalism", das schon wenig später, 1981, auf Deutsch erschien und zu einem Zeitpunkt für Debatten sorgte, da in Iran "islamische Revolutionäre" den prowestlichen Schah stürzten und eine Ordnung auf islamisch-religiöser Grundlage zu errichten im Begriffe waren. Der Autor erweiterte und vertiefte seine These 1994 in dem Werk "Culture and Imperialism", von der Orientalistik weg hin zu den Kulturwissenschaften generell.
Edward Said, bis zu seinem Tod 2003 ein enger Freund des Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim und Mitinitiator des "Westöstlichen Divan-Orchesters", 1935 in Palästina geboren und - wie er schreibt - "in zwei britischen Kolonien aufgewachsen", Palästina und Ägypten, wollte provozieren, bewusst einseitig sein - was ihm auch gelang. Sosehr ihm viele im Sinne einer Eurozentrismus-Kritik zugestanden, dass es, sei es unter christlich-missionarischen, sei es unter imperialistischen Vorzeichen, mit der "Wertfreiheit" der Orientforschung, erst recht bei ohnehin subjektiven künstlerischen Darstellungen gewiss gehapert habe, so sehr waren andere westliche Gelehrte, etwa Montgomery Watt, Albert Hourani oder - dieser ganz besonders - Bernard Lewis, der Meinung, dass er mit seiner pauschalen These über das Ziel hinausgeschossen sei. Es gibt sogar muslimische Kritiker, wie Sadiq Dschalal al Azm oder den Dissidenten Ibn Warraq ("Defending the West"), die Saids These vehement widersprechen und sie im Grunde als kontraproduktiv für eine Erneuerung des Islams bezeichnen. Ibn Warraq sieht in Saids Argument eine "Entlastung der Muslime", die ihren selbstgerechten Eigendünkel verfestige und den sowieso großen Mangel an Kritik und Selbstkritik noch stabilisiere. Ibn Warraq - um dies richtig einordnen zu können - versteht sich als so etwas wie der Bertrand Russell des Islams.
Immerhin wurde Saids These, auch unter dem Eindruck aktueller politischer Einseitigkeiten und Verzerrungen, wie man sie vor allem im Palästina-Konflikt auf westlicher Seite bis heute beständig ausmachen kann, von anderen eine in jedem Fall bedenkenswerte Schlüssigkeit zugestanden; etwa in dem Sinne, dass kulturwissenschaftliches Erkenntnisstreben sich eben nicht im luftleeren Raum abspiele, dass es zumindest für Interessen instrumentalisiert werden könne und dass das natürlich auch nachweislich vorgekommen sei, im Orient wie anderswo.
Die jetzt erschienene Neuauflage des Buches, gleichzeitig eine neue, gut lesbare Übersetzung von Hans Günter Holl, der aus aktuellen Anlässen ein Nachwort Saids von 1994 und ein Vorwort von 2003 hinzugefügt wurden, wird die Diskussion unter Orientalisten und Kulturwissenschaftlern weiterhin anregen, zumal sich nach dem "11. September" die Verhältnisse noch massiv zugespitzt haben. Ein Klassiker seines Genres ist das Buch längst. In der ersten Ergänzung antwortet Said seinen Kritikern, insbesondere seinem "Intimfeind" Lewis, im zweiten Zusatz ist der damals gerade laufende Irak-Krieg Anlass für Aktualisierungen, die uns noch heute bewegen und dies weiterhin tun werden.
Vor allem die französische und englische, später die amerikanische Orientwissenschaft (doch auch Literatur und Kunst) nahm Said aufs Korn. Die deutsche Orientwissenschaft, seit Heinrich Leberecht Fleischer, Ignaz Goldziher oder Theodor Nöldeke stark historisch-philologisch "orientiert", nahm Said ausdrücklich aus, wohl auch, weil er zu wenig über sie wusste und weil die imperialen Interessen Deutschlands vergleichsweise marginal blieben. Franzosen und Engländer (Sylvestre de Sacy, Richard Burton und andere) haben nach seiner Ansicht ein Bild vom Orientalen gezeichnet, das auf essentialistische Weise den "ganz Anderen" und somit das "ganz Andere" repräsentiere. Im Unterschied zum Europäer, der tatkräftig handle, logisch denke und eben tüchtig sei, habe man es beim Orientalen mit einem emotionalen Träumer zu tun, der nicht logisch, sondern sprunghaft oder intuitiv denke, der sich nicht selbst regieren könne, außer durch die orientalische Despotie; zudem sei er fatalistisch, träge, grausam und triebhaft - eine Vorstellung, die schon auf mittelalterliche christliche Polemiken zurückgeht. Westliche Autoren, auch die sogenannten Maler des Orientalismus, erzeugten durch Harems-Beschreibungen und Szenen aus dem Hamam, dem "türkischen Bad", tatsächlich ein Bild vom "lasziven Orient", das nachwirkt. Der Westen - so das Stereotyp - sei rational und planerisch, der Orient "mysteriös und mystisch", dem Ewigen im Zeitlichen zugewandt. Vor allem die Politiker des Kolonialismus, ein Lord Cromer oder Arthur Balfour, aber auch noch die Politiker unserer Ära (bis hin zu George W. Bush) hätten solche Phantasmagorien und Konstrukte als Rechtfertigung imperialer Stärke und Herrschaft oder zumindest von politischen "Einflusssphären", wie das im postkolonialen Zeitalter heißt, eingesetzt.
Man wird nicht bestreiten können, dass solcherlei Kritik Richtiges trifft. Sie hat in den vergangenen dreißig Jahren dazu geführt, dass in den Kulturwissenschaften stärker als bisher über die eigenen Ansätze reflektiert worden ist. Die Orientalistik ist durch Saids Fundamentalkritik - wie auch durch die grundstürzenden Ereignisse in der islamischen Welt selbst, die ein Verstehen erheischen - vom Orchideenfach zu einer Wissenschaft geworden, von der man sich nun erhofft, sie könne verlässlicher sagen, "wie der Muslim tickt". Dies freilich kann sie wahrscheinlich in einem befriedigenden, "objektiven" Sinn gar nicht. Und Said hat nicht wenig dazu beigetragen, dass das Selbstverständnis der Forscher zum Thema der Wissenschaft selber wurde.
In dem zweiten Zusatz des Autors wird deutlich, dass der gesamte Komplex angesichts des Irak-Krieges - zu dem kein Geringerer als Bernard Lewis Präsident Bush riet -, Afghanistans und des Aufstieges von Al Qaida und der dschihadistischen Gruppen noch brisanter, weil bedrohlicher geworden ist. Orientalisten wie John Esposito und bekannte Nahost-Publizisten wie Robert Fisk gehörten denn auch zu den beredten Verteidigern Saids in der Kontroverse.
Zu den eher kritischen Anmerkungen zu diesem Klassiker gehört allerdings auch, dass der Autor, ohne es zu wollen, den radikalen, terroristischen Elementen in der islamischen Welt ihre willkommenen Stichworte geliefert hat. Eine ohnehin oft zum Verschwörungsdenken, der "mu'amara", neigende Region bekam von ihm bequeme Erklärungen und Rechtfertigungen für ihr historisches Zurückbleiben, das man, ebenfalls essentialistisch, weniger dem eigenen Versagen als vielmehr den bösartigen Machenschaften anderer zuschreiben konnte. Der islamistische Diskurs lebt zu großen Teilen davon. Seither kursieren in Arabien und anderswo auch Listen mit den Namen "guter" und "schlechter" Orientalisten. Man kann sich leicht ausrechnen, welche als die guten gelten und welche als die schlechten. Doch die Diskussion wird weitergehen.
WOLFGANG GÜNTER LERCH
Edward W. Said: "Orientalismus". Aus dem Englischen von Hans Günter Holl. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009. 459 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Die nun vorliegende Neuübersetzung von Edward Saids "Orientalismus" hat Rezensent Stefan Weidner nicht wirklich überzeugt. Prinzipiell begrüßt er das Vorhaben, scheint ihm doch die erste deutsche Übertragung dieses wichtigen Werks des palästinensisch-amerikanischen Literaturwissenschaftler Edward Said (1935-2003) nicht frei von Mängeln. Zu seinem Bedauern ist die neue Übersetzung nicht besser: er hält ihr vor, von "atemberaubender Nachlässigkeit" zu sein und Sätze zu liefern, die "rundweg unverständlich" sind. Dass Saids Werk bei seinem Erscheinen 1978 die wissenschaftliche Orientalistik traumatisierte und spaltete, kann er bei der erneuten Lektüre dieses Klassikers nicht so ganz nachvollziehen. Saids Thesen bezüglich der Orient-Klischees und der ideologischen, ja oft rassistischen Haltungen der Orientalistik erscheinen Weidner heute "selbstverständlich". Bisweilen mutet ihn das Buch wie ein "konfuser Essay" an. Nichtsdestoweniger würdigt er die Bedeutung dieses Werks, das viel angestoßen und die Wissenschaft weiter gebracht hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH