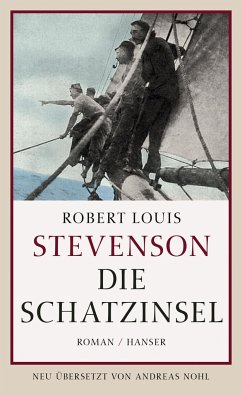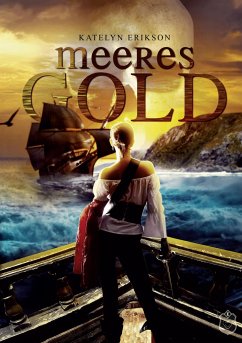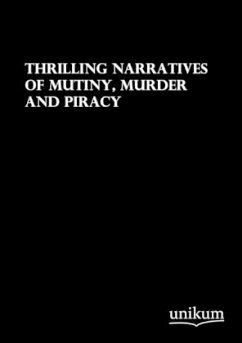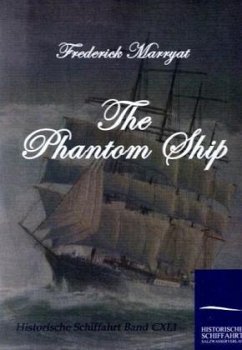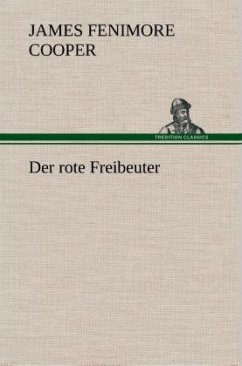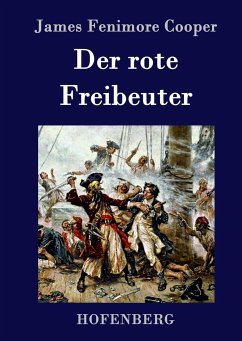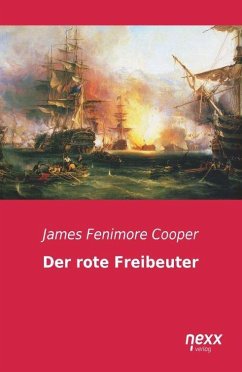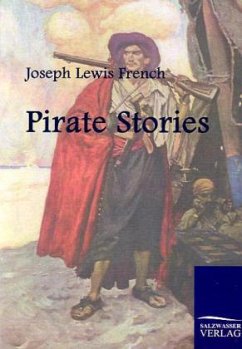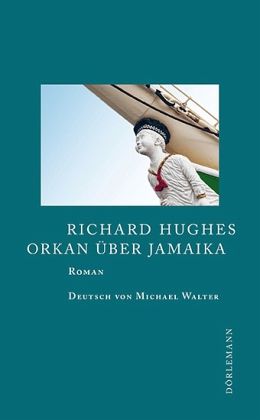
Orkan über Jamaika
Roman
Übersetzung: Walter, Michael

PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
Atemberaubende Abenteuer auf hoher SeeIm Mittelpunkt des Romans steht die zehnjährige Emily Bas-Thornton. Sie lebt mit ihrer Familie auf Jamaika, doch als ein Orkan über die Insel hinwegfegt und das Wohnhaus der Familie davonträgt, beschließen die Eltern, ihre Kinder nach England heimzuschicken. John, Emily und die 'Krümel' werden einem Schiff anvertraut, das jedoch gekapert wird. Die Kinder bleiben durch eine Verknüpfung unglücklicher Umstände an Bord des Schiffes mit den überaus freundlichen Piraten ... und erleben in der Folge zahlreiche Abenteuer, ehe sie an Bord eines Dampfers na...
Atemberaubende Abenteuer auf hoher SeeIm Mittelpunkt des Romans steht die zehnjährige Emily Bas-Thornton. Sie lebt mit ihrer Familie auf Jamaika, doch als ein Orkan über die Insel hinwegfegt und das Wohnhaus der Familie davonträgt, beschließen die Eltern, ihre Kinder nach England heimzuschicken. John, Emily und die 'Krümel' werden einem Schiff anvertraut, das jedoch gekapert wird. Die Kinder bleiben durch eine Verknüpfung unglücklicher Umstände an Bord des Schiffes mit den überaus freundlichen Piraten ... und erleben in der Folge zahlreiche Abenteuer, ehe sie an Bord eines Dampfers nach England gelangen. Richard Hughes erzählt in einem atemberaubenden Abenteuerroman, dass das Berüchtigte keineswegs so gefährlich und das Unschuldige so harmlos ist, wie es den Anschein macht.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.