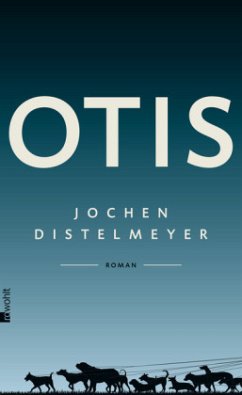AM ANFANG WAR MUSIK.
Mit "Otis", seinem ersten Roman, wechselt Jochen Distelmeyer das Genre, ohne auf den ihm eigenen dichterischen Ton zu verzichten. Er nimmt uns mit auf eine irrlichternde Reise durch eine Welt in der Schwebe.
Das Berlin der Gegenwart, genauer: wenige Tage im Februar 2012 bilden den Hintergrund des Geschehens. Der Bundespräsident ist zurückgetreten. Eine Gruppe barbusiger Feministinnen sorgt in Davos für Aufsehen. George Clooney gesteht Schlafprobleme und so auch: Tristan Funke.
Er ist ein Schwärmer, ein Mann, dem die Gegenwart längst als etwas Vergangenes erscheint. Erst vor kurzem ist er in die Hauptstadt gezogen, um eine alte Liebe zu vergessen, um ein Buch zu schreiben über die Erlebnisse seiner privaten Odyssee. Begegnungen mit Nymphen, Zauberinnen und Götterboten. Leuten mit Flügeln.
Da sind die Fotografin Leslie und die Schauspielerin Stella, die nichts voneinander wissen, und Tristans Cousine Juliane, mit einem Taschengeld, von dem der Literat zwei Monatsmieten begleichen könnte, und einer kaum zu bändigenden Feierfreude.
Dabei hat Tristan schon genug zu tun mit einem potenziellen Verleger namens Zaller. Vor allem aber ringt er mit dem Abschied von Musikerfreund Ole, der mit seiner Familie in den USA einen Neuanfang wagen will. Bei einer letzten großen Party in der Gypsy Bar treffen Vergangenheit und Zukunft, Tristan und seine Geliebten auf einander. Und das mit Folgen.
Mit "Otis", seinem ersten Roman, wechselt Jochen Distelmeyer das Genre, ohne auf den ihm eigenen dichterischen Ton zu verzichten. Er nimmt uns mit auf eine irrlichternde Reise durch eine Welt in der Schwebe.
Das Berlin der Gegenwart, genauer: wenige Tage im Februar 2012 bilden den Hintergrund des Geschehens. Der Bundespräsident ist zurückgetreten. Eine Gruppe barbusiger Feministinnen sorgt in Davos für Aufsehen. George Clooney gesteht Schlafprobleme und so auch: Tristan Funke.
Er ist ein Schwärmer, ein Mann, dem die Gegenwart längst als etwas Vergangenes erscheint. Erst vor kurzem ist er in die Hauptstadt gezogen, um eine alte Liebe zu vergessen, um ein Buch zu schreiben über die Erlebnisse seiner privaten Odyssee. Begegnungen mit Nymphen, Zauberinnen und Götterboten. Leuten mit Flügeln.
Da sind die Fotografin Leslie und die Schauspielerin Stella, die nichts voneinander wissen, und Tristans Cousine Juliane, mit einem Taschengeld, von dem der Literat zwei Monatsmieten begleichen könnte, und einer kaum zu bändigenden Feierfreude.
Dabei hat Tristan schon genug zu tun mit einem potenziellen Verleger namens Zaller. Vor allem aber ringt er mit dem Abschied von Musikerfreund Ole, der mit seiner Familie in den USA einen Neuanfang wagen will. Bei einer letzten großen Party in der Gypsy Bar treffen Vergangenheit und Zukunft, Tristan und seine Geliebten auf einander. Und das mit Folgen.

Der Name seiner Band Blumfeld ist von Kafka geliehen, aber in seinem Roman "Otis" versucht Jochen Distelmeyer jetzt zu schreiben wie Thomas Mann. Es geht um Berlin, Partys und eine verlorene Liebe.
Der Held hier heißt wie eine frühe Erzählung Thomas Manns: Tristan, und damit nicht genug: Er sieht in den flüchtigen Bekanntschaften und Affären, mit denen er sich nach der Trennung von seiner großen Liebe zu trösten versucht, "Wiedergänger des mythischen Personals der Vorzeit". Das ist bekanntlich das erzählerische Programm von Thomas Manns Novelle "Der Tod in Venedig".
Aber Tristan Funke ist kaum ein würdiger Wiedergänger des Großschriftstellers Gustav von Aschenbach, eher ein durchschnittlicher "Junggeselle. Mitte dreißig. Verträumt, etwas wehmütig", und mit Detlev Spinell, der Schriftstellerfigur aus Manns "Tristan", verbindet ihn allenfalls, dass er wie jener mit seinen Schreibversuchen "jämmerlich langsam von der Stelle kommt".
Das gilt auch für das literarische Debüt von Jochen Distelmeyer, das von diesem Tristan Funke erzählt. Den Namen seiner Diskursrockband Blumfeld hatte Distelmeyer sich einst von Kafka geliehen. Nun liest man in seinem Buch lauter Namen, die fast wie von Thomas Mann geliehen klingen, aber auch nur fast: Nora Thränhardt, Carola Frohgemut oder Jesko Paulsen heißen seine Figuren, und (Achtung, Großmeistersatz!): "Alle nahmen sie teil an den komplexen Segnungen und Gewissheiten der Metropole, die sich bereitgemacht hatte, auch an diesem Tag die ganze Pracht ihrer Errungenschaften zu entfalten."
Wohlgemerkt: Es handelt sich hier um einen Text des Jahres 2015, der im Berlin dieser Gegenwart spielt. Aber die stilistische Kolportage Thomas Manns hält Distelmeyer ohnehin nur ein paar Seiten lang durch. Danach bleibt seinem Roman eine personale Erzählweise des neunzehnten Jahrhunderts, die ihre Figuren oft schon im Moment der Vorstellung hinrichtet: "Cornelius Wegener war ein erfolgreicher und angesehener Anwalt aus Düsseldorf", "Victoria Krüger war so etwas wie eine moderne Salondame der Stadt". Andere heißen Freimut, studieren Jura in Oxford und nennen ihren Vater "Paps".
Mit solchen Pappkameraden ist nach wenigen Seiten schon nichts mehr zu machen, und deshalb braucht Distelmeyer so viele von ihnen. Aber das ist noch nicht das größte Problem des Buches: Noch schwerer trägt es an der Last einer romantischen (oder wenn man will auch postmodernen) Metafiktion: An nichts weniger als einer aktualisierten Version von Homers "Odyssee" arbeitet nämlich der junge Tristan. Sein Buch trägt den Arbeitstitel "Otis", und so heißt auch Distelmeyers Roman. Der Leser wird freundlicherweise darüber aufgeklärt, dass in Otis jener Name anklinge, den Odysseus sich gegenüber dem Polyphem gab, "Outis", was "Niemand" bedeutet, aber darüber hinaus auch noch der "große Sänger eines noch unverwundenen Trennungsschmerzes, Otis Redding, sowie der gleichlautende Firmenname eines Herstellers von Fahrstühlen". Und aus dieser famosen Koinzidenz folgt genau: nichts.
Bei den "Mutmaßungen zur Aktualität der Odysseus-Sage und ihrer tieferen Bedeutung", die Tristan angeblich in seinem Romanprojekt anstellt, bleibt es eben bei der bloßen Behauptung, sie mündet allenfalls in eine Karikatur, denn Tristans Odysseus soll ein Programmierer sein, der auf Ibiza Drogentrips durchlebt. Auf der Metaebene beginnt man dann als Leser natürlich zu suchen, ob nicht auch Tristan selbst eine gespiegelte Odyssee durchlaufe - und freilich kann man sagen, er sei auf Irrfahrt: Er muss den Sirenen widerstehen und teilt mit mancher Kalypso das Bett, während er sich doch zu seiner Penelope zurücksehnt, die hier Saskia heißt und mit der es schließlich zu einem ziemlich unspektakulären Wiedersehen kommt. Aber mit der künstlerischen Qualität, mit der Schriftsteller wie Joyce oder Döblin antike Stoffe in die moderne Großstadt übertragen haben, hat das wirklich nichts zu tun.
Die Passagen, in denen Distelmeyer gelegentlich eine Neuerzählung der griechischen Sage einstreut, wirken wie mit Gewalt montiert, überhaupt fügt sich die Erzählung nicht zu einem harmonischen Ganzen. Sie zerfällt in Fingerübungen, darunter eine Episode über einen deutschtürkischen Busfahrer, die, wie man in einer Anmerkung erfährt, inspiriert ist von Gerhart Hauptmanns Novelle "Bahnwärter Thiel". Von der Hauptfigur erfährt man im Grunde nur sehr wenig, stattdessen werden seitenlang Berliner Kulturbetriebsepisoden geschildert, die oft wie angelesene oder nachgedichtete Feuilletonkritiken klingen. Wenn die Romanhandlung bestimmte Orte streift wie das Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals oder den Tierpark Friedrichsfelde, wird aus unerfindlichen Gründen lexikonhaft deren Geschichte erzählt.
Das Überraschendste an diesem Buch ist, dass Distelmeyer, der als Lieddichter mit Blumfeld und als Solokünstler gewiss viele Meriten hat, sprachlich auf ganzer Linie enttäuscht. Es gibt kaum einen einzigen literarisch interessanten Satz darin, dafür umso mehr fast unglaublich banale. Da heißt es etwa, jede Party sei "ein wenig wie das Leben selbst. Die Leute kamen und gingen. Einige früher, andere später." Wenn einmal Dinge karikiert werden, schießt Distelmeyer gleich mit Kanonen auf Spatzen: Für ein Restaurant mit überkandidelter Nouvelle Cuisine genügt da nicht die Erwähnung von "Saiblingscarpaccio mit Chicoree-Haselnuss-Salat", sondern die Aufzählung füllt fast eine Seite. Und der Verleger, der Tristans Manuskript im Handstreich ablehnt, schlägt zur Verbesserung der aktualisierten Odyssee Folgendes vor: "Theiresias: Natürlich ein transsexueller Taxifahrer! Analsex! So was wollen die Leute lesen." Damit geht auch die Andeutung eines Schlüsselromans fehl, denn wer sollte sich von derlei platten Überzeichnungen getroffen fühlen?
Es fragt sich sogar, ob die Erzählhaltung dieses Romans selbst ironisiert werden soll, denn tatsächlich ist es ein derart holzhammerpsychologisierendes, immer sofort auf den Begriff kommendes Narrativ, von dem sich moderne Erzähler seit mehr als hundert Jahren abgrenzen. Dann wäre, gemäß Blumfeld-Ästhetik, "Otis" eine literarische Version der vieldiskutierten "Apfelmann"-Lieder. Aber zu einem Buch kann man leider nicht tanzen, nicht mal ironisch.
JAN WIELE
Jochen Distelmeyer: "Otis". Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2015. 284 S., geb., 19,95[Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Diedrich Diederichsen ist sich nicht ganz sicher, ob er Jochen Distelmeyers Debütroman "Otis" nicht analytisch von etwaigen Absichten des Autors entfernt. Absichten hin oder her, jedenfalls erkennt der Rezensent eine Variation der "Mise en abyme", des Abgrunds, der unter dem nur scheinbar trittfesten Boden des alltäglichen Sinnschauspiels klafft. Während eine Ebene des Romans so klingt, "als wollte uns Wikipedia eine Liebesgeschichte erzählen", die lediglich eine "Sozialsimulation von Netz und Nachtleben" wiederkäut, soll der Protagonist (und angehende Schriftsteller) Tristan Funke durch den Dreck des wahren, alten, fiesen Berlins aus dem Schlummer des kulturbeflissenen Dauerschlafs geweckt werden, fasst Diederichsen zusammen. Leider ist ein Abgrund aber kein bloß doppelter Boden, sondern das bodenlose, erklärt der Rezensent, der das Buch seiner mangelnden Hingabe an den Absturz wegen nur "mittelinteressant und halbamüsant" findet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Kein anderer deutscher Songschreiber beherrscht es in gleicher Weise, die fein nuancierten, manchmal furchtbar diffusen Gefühle, die uns umtreiben, so anrührend und präzise, so brutal klar in Worte und Musik zu fassen wie er ... Danke, Jochen. Spiegel Online