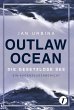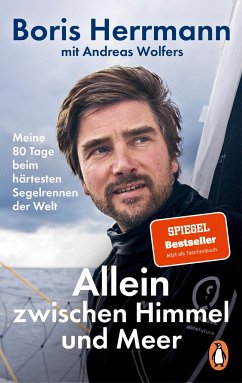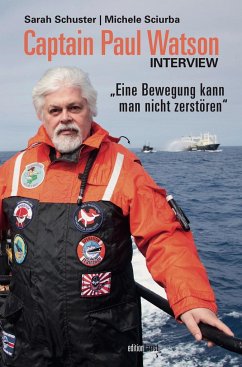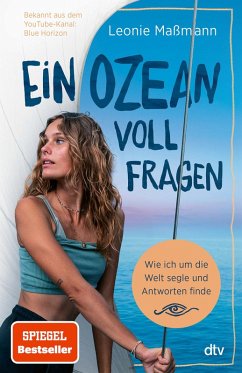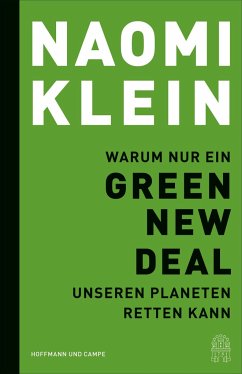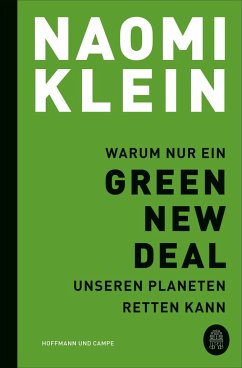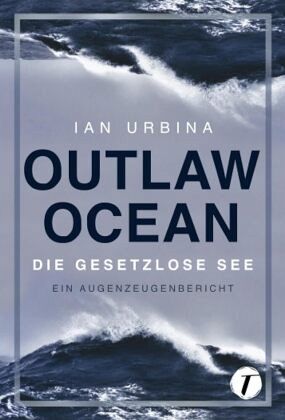
Outlaw Ocean
Die gesetzlose See
Übersetzung: Lampa, Tanja; Fricke, Kerstin; Hahn, Claudia
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
16,99 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In der gesetzlosen Weite der Ozeane gibt es kaum Zeugen ... eine mutige Reportage, spannender als jeder Thriller.Die Ozeane sind die wildesten, gefährlichsten Gegenden unseres Planeten, unwirtlich und unkontrollierbar. Der Journalist und Pulitzerpreisträger Ian Urbina hat auf jahrelangen Recherchereisen Piraten, Söldner, Wilderer, Schmuggler und Sklaven aufgespürt, Umweltschützer und -verschmutzer in Aktion erlebt und seine Erfahrungen in diesem Buch dokumentiert.Er deckt auf, wie kriminelle Banden auf der Hochsee mit illegalem Fischfang Milliarden verdienen, ihre Mannschaft ausbeuten und...
In der gesetzlosen Weite der Ozeane gibt es kaum Zeugen ... eine mutige Reportage, spannender als jeder Thriller.
Die Ozeane sind die wildesten, gefährlichsten Gegenden unseres Planeten, unwirtlich und unkontrollierbar. Der Journalist und Pulitzerpreisträger Ian Urbina hat auf jahrelangen Recherchereisen Piraten, Söldner, Wilderer, Schmuggler und Sklaven aufgespürt, Umweltschützer und -verschmutzer in Aktion erlebt und seine Erfahrungen in diesem Buch dokumentiert.
Er deckt auf, wie kriminelle Banden auf der Hochsee mit illegalem Fischfang Milliarden verdienen, ihre Mannschaft ausbeuten und sich immer wieder den Behörden entziehen. Ein packender Erlebnisbericht und ein kenntnisreiches Porträt unerschrockener Idealisten, skrupelloser Kapitäne und brutaler Geschäftemacher.
Die Ozeane sind die wildesten, gefährlichsten Gegenden unseres Planeten, unwirtlich und unkontrollierbar. Der Journalist und Pulitzerpreisträger Ian Urbina hat auf jahrelangen Recherchereisen Piraten, Söldner, Wilderer, Schmuggler und Sklaven aufgespürt, Umweltschützer und -verschmutzer in Aktion erlebt und seine Erfahrungen in diesem Buch dokumentiert.
Er deckt auf, wie kriminelle Banden auf der Hochsee mit illegalem Fischfang Milliarden verdienen, ihre Mannschaft ausbeuten und sich immer wieder den Behörden entziehen. Ein packender Erlebnisbericht und ein kenntnisreiches Porträt unerschrockener Idealisten, skrupelloser Kapitäne und brutaler Geschäftemacher.