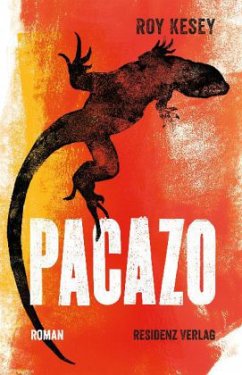John Segovia, Amerikaner in Peru, ist ein liebenswerter Freund, ein überschwänglicher Liebhaber und ein leidenschaftlicher Historiker: Seine Faszination gilt der grausamen Geschichte der Inkas und Konquistadoren, seine Besessenheit aber der Suche nach dem unbekannten Mörder seiner geliebten Frau Pilar, die eines Abends vom Nachtmarkt nicht mehr zurückgekehrt ist. Zerrissen zwischen dem Wunsch nach Rache, schmerzhaften Erinnerungen und dem Alltag mit seiner kleinen Tochter Mariángel, wandert John durch die pulsierende Stadt Piura.
Auf seinem Weg zurück ins Leben helfen John sein trockener Humor, sein buntgemischter Freundeskreis und eine neue Liebe.
Auf seinem Weg zurück ins Leben helfen John sein trockener Humor, sein buntgemischter Freundeskreis und eine neue Liebe.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Die ersten hundert Seiten von Roy Keseys Roman "Pacazo" haben Jakob Strobel y Serra erst einmal imponiert. Der amerikanische Historiker John Segovia reist durch Peru, erforscht die spanische Conquista, heiratet eine seiner Studentinnen, die dann in der Wüste brutal ermordet wird, fasst der Rezensent zusammen. Segovia klammert sich verzweifelt am Alltag fest, an lauter Banalitäten, und kehrt immer wieder an den Ort des Verbrechens zurück, um nach Spuren zu suchen. Nur entwickelt Kesey daraus auf den nächsten fünfhundert Seiten weder Handlung noch Spannung, kein Seelendrama, keine Verschwörung oder sonst irgendetwas, was das weiterlesen gelohnt hätte, bedauert Strobel y Serra. Die stellenweise brillante Collagetechnik mag anfangs darüber hinwegtrösten, bald jedoch nicht mehr, so der Rezensent, der auch zunnehmend genervt vom "sparsamen Koloritkonfetti" fragt, was der Autor sich wohl dabei gedacht haben könnte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Roy Kesey will in "Pacazo" einen Mord aufklären und dreht sich doch nur sechshundert Seiten lang im Kreis
Wir sind in eine Falle getappt. Viel zu spät haben wir es gemerkt, viel zu lange auf Besserung gehofft und ärgern uns jetzt fast noch mehr über uns selbst als über die Hybris eines Autors, der seinen ersten Roman gleich zu einem Sechshundert-Seiten-Schinken aufdonnert. Zu unserer Verteidigung können wir nur vorbringen, dass die Falle gut gestellt und der Anfang des Buches vielversprechend war: Der junge amerikanische Historiker John Segovia reist durch Peru, strandet in der Stadt Piura, bekommt eine Anstellung als Englischlehrer, erforscht nebenbei die Geschichte der spanischen Conquista, verliebt sich in eine seiner Studentinnen, heiratet sie und zeugt mit ihr ein Kind.
Doch kurz nach der Geburt wird seine Frau verschleppt, vergewaltigt, halbtot geprügelt und sterbend in der Wüste zurückgelassen. Die Suche nach dem Mörder wird für Segovia zur Obsession. Er leidet wie ein Hund, hat keine andere Spur als das unvollständige Kennzeichen eines Taxis, geht immer wieder in die Wüste, um am Tatort nach Beweisen zu suchen, findet seltene Momente des Glücks nur in den Armen einer Hure nach einer halben Flasche Bourbon und beim Schmusen mit seiner Tochter. Allein das Baby bewahrt ihn vor dem Abgrund des rettungslosen Welthasses. Und trotzdem gerinnt Segovias Ironie immer zu Sarkasmus, weil jede Freude von Verbitterung vergiftet wird.
Das Ganze wird in einer Collagetechnik erzählt, die manchmal affektiert, manchmal aber auch brillant ist. Handlung und Halluzination, Tagtraum und innerer Monolog, Gegenwart und Vergangenheit, das kurze Eheglück und die Kindheit in den Vereinigten Staaten, die Eroberung des Inka-Reiches und die Stunden des Mordabends - alles wird tollkühn vermischt, oft in einem Absatz, mitunter sogar in einem einzigen Satz, der zum Parforceritt von Piura zu Pizarro und wieder zurück wird. Auch die Sprache klingt zu Beginn so verlockend wie ein Sirenenruf. Sie ist schnell, präzise, geschmeidig, schnörkellos, wird zum Stakkato, wenn sie die Ruhelosigkeit des Helden widerspiegelt, und lässt immer wieder einen trockenen Witz aufblitzen, etwa wenn es heißt: "Aus der Anlage kommt ein Lied von Rubén Blades. Er gilt als der Intellektuelle des Salsa. Das ist ungefähr so, als ob man vom Intellektuellen des Kabeljaus oder des Klebstoffs sprechen würde." Oder: "Wir fahren ins städtische Krankenhaus. Die Wände sind seit Längerem nicht gestrichen worden. Die Geräte sind seit Längerem nicht mehr erneuert worden. Die Krankenschwestern auch nicht."
So gehen die ersten hundert Seiten ins Land. Wir nehmen an John Segovias Alltag teil, begleiten ihn jeden Tag zur Arbeit und selten ins Bordell, schauen mit ihm und seinen Kumpels Fußball, bringen gemeinsam das Kind ins Bett, dazu gibt es ein bisschen peruanische Folklore und Volksmusik als sparsames Koloritkonfetti. Und dann? Noch einmal hundert Seiten und nichts Neues. Und dann? Hundert weitere Seiten und immer noch dasselbe: wieder Windelwechsel, wieder Kollegentratsch, wieder zu viel Bourbon, aber keine Spannung, keine Beschleunigung, keine Intensivierung, kein Seelendrama, kein Entwicklungsroman, keine Kriminalgeschichte, keine Weltverschwörung, kein Lowry, kein Winslow. Irgendwann, schon mehr dämmernd als dösend, haben wir begriffen, dass wir in einem Spinnennetz aus schönen Sprachfäden und sterbenslangweiligen Banalitäten verstrickt sind, dass wir uns sechshundert Seiten lang im Kreis drehen, dass wir auf eine Handlung warten können, bis wir schwarz werden. Was haben wir dem Autor nur getan, dass er uns so grausam mit seiner Phantasielosigkeit straft?
JAKOB STROBEL Y SERRA
Roy Kesey: "Pacazo". Roman.
Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Residenz Verlag, Wien 2014. 608 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main