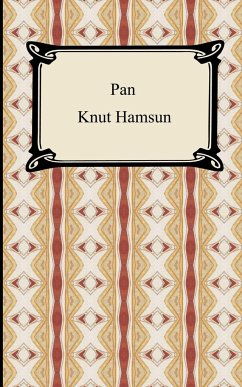One of Knut Hamsun's most famous works, "Pan" is the story of Lieutenant Thomas Glahn, an ex-military man who lives alone in the woods with his faithful dog Aesop. Glahn's life changes when he meets Edvarda, a merchant's daughter, whom he quickly falls in love with. She, however, is not entirely faithful to him, which affects him profoundly. "Pan" is a fascinating study in the psychological impact of unrequited love and helped to win the Nobel Prize in Literature for Hamsun.

Als die Fiktion vom Charakter Abschied nahm: Aus Anlass des hundertfünfzigsten Geburtstags erscheinen Knut Hamsuns Romane "Hunger" und "Pan" in neuer Übersetzung.
Von Wolfgang Schneider
Mal nennt er sich Andreas Tangen, mal Wedel-Jarlsberg. Den wirklichen Namen des jungen Selbstquälers erfahren wir nicht. Woher er kommt, auch nicht. Nur so viel: In Kristiania (der alte Name für Oslo) sucht er unter schweren Entbehrungen Anerkennung als Journalist und Schriftsteller. Er schreibt an einer Abhandlung über die "Verbrechen der Zukunft". Kein Zweifel, wir haben es mit einem norwegischen Raskolnikow zu tun - schon sein Zimmerchen, ein "klammer, unheimlicher Sarg", verweist literarisch nach Petersburg.
Ein Verbrecher aus Mutwillen ist Hamsuns Held allerdings nicht. Mehr noch als der Hunger peinigt ihn die Scham. Und nichts findet er verächtlicher als die Gier, die seinen eigenen Zustand spiegelt. Der Anblick einer Frau, die von den Auslagen einer Metzgerei allzu beeindruckt ist, widert ihn an: Der eine verbliebene Zahn in ihrem Mund "sah aus wie ein kleiner Finger, der aus dem Kiefer ragte, und ihr Blick war voll Wurst". Bah!
Hamsuns "Hunger", ein Pionierwerk der literarischen Moderne und noch heute eine grandiose Leseerfahrung, ist eine schwarze Komödie der Scham. Vielfältig sind die Strategien, mit denen der Hungernde sein Elend vor der Mitwelt kaschiert. Wenn er besorgt gefragt wird, wie es ihm gehe, antwortet er mit Verve: "Doch, über Erwarten!" Der Stolz des Gedemütigten nimmt aberwitzige Züge an. Als ein Krüppel ihn um eine milde Gabe bittet, erträgt er es nicht, nichts zu geben. Rasch bringt er seine Weste zum "Onkel" (so nennt er den Pfandleiher) und drückt dem Krüppel das Geld in die Hand - um ihn sich "vom Hals zu schaffen". Großspurig fügt er hinzu: "Es freut mich, dass Sie sich zuerst an mich gewandt haben."
Ist das nun eine gute Tat oder ihr Gegenteil? Auf jeden Fall handelt es sich um Hamsuns Kunst der Ambivalenz. Statt mit einem geradlinigen Motiv bekommen wir es mit einem Kreuzfeuer widerstreitender Antriebe zu tun. Hier ist das "Ich" offensichtlich nicht mehr Herr im eigenen Haus. Viele Autoren haben um 1900 mehr oder weniger schulmäßig eine Psychologie des Unbewussten zu inszenieren versucht. Keiner hat das "Ich" so souverän entmachtet wie Hamsun.
"Hunger" zeigt ein neues Interesse an psychischen Grenzzuständen, die hier schon in einer Art Bewusstseinsstrom protokolliert werden. Tiefste Mutlosigkeit und Verzweiflung wechseln mit Attacken wilder Hoffnung. Sogar im Obdachlosenasyl, wo der junge Mann eine Nacht verbringt, schwingt er sich jäh zu wahnhafter Selbstherrlichkeit auf: "Ich bildete mir ein, ein neues Wort erfunden zu haben . . . Das gibt es in der Sprache bisher nicht . . . Kuboaa. Es hat Buchstaben wie ein Wort, beim lieblichsten Gott, Mann, du hast ein Wort erfunden . . . Kuboaa . . . von großer grammatikalischer Bedeutung."
Siegfried Weibels Neuübersetzung, ergänzt um ein luzide begeistertes Nachwort von Daniel Kehlmann, ist makellos. Sie beweist viel Sinn für die "erschreckende Lustigkeit", die Thomas Mann an Hamsun rühmte. Sie macht sich etwa geltend, wenn der Hungernde von seiner Wirtin rausgeschmissen wird: "Bei reiflicher Überlegung kam mir Frau Gundersens Kündigung einigermaßen gelegen. Dies war eigentlich kein Zimmer für mich. Hier waren ziemlich ordinäre grüne Vorhänge vor den Fenstern. Der armselige Schaukelstuhl dort in der Ecke war strenggenommen nur der Witz von einem Schaukelstuhl, über den man sich leicht kranklachen konnte." Solche Ironie, die sich nicht gegen die Außenwelt richtet, sondern die eigene Misere preist, kehrte zwei Jahrzehnte später wieder in Robert Walsers Diener-Roman "Jakob von Gunten".
Allerdings sind die Symptome des Hungers, die mit klinischer Genauigkeit geschildert werden, alles andere als spaßig. Wegen Schwindelgefühlen bleibt der junge Mann ganze Tage im Bett, solange er noch eines hat. Die Haare fallen ihm in Büscheln aus, die Sinne versagen, der Bauchschmerz ist unerträglich, die Eingeweide rebellieren, und er muss sich "mal hier, mal da" auf der Straße erbrechen, wenn er endlich etwas zu sich nimmt. Er kaut auf Holzspänen herum und nuckelt an Steinen. Eine schauerliche Szene des beginnenden Auto-Kannibalismus schildert, wie der Hungernde im Dämmerzustand an seinen Fingern knabbert, bis Blut kommt. Kurz: Hunger ist hier keine Metapher.
Eher griechische Zustände herrschen dagegen bei Leutnant Glahn. Pan ist hier der Schirmherr - der bocksfüßige Gott der Hirten und Jäger, dem gewaltige Lüsternheit zugeschrieben wird. Der dreißigjährige Leutnant ist etwas zivilisationsmüde, er versucht sich als Waldgänger und verbringt den Sommer 1855 in einer Hütte hoch oben im norwegischen Norden. Das Vorleben dieses Aussteigers wird in "Pan" mit keinem Satz thematisiert. Stattdessen liest man stimmungsvolle Beschreibungen, die Glahns schwärmerisches Naturerleben im Land der Mitternachtssonne vergegenwärtigen. Wir begleiten den schießfreudigen Jäger auf seinen Streifzügen in der Herrgottsfrühe. Das romantische "Zurück zur Natur" hat allerdings Grenzen: Eigentlich ist Glahn ja bereits ein moderner Tourist. In der nahen Handelsstation, wo abends gefeiert wird, trifft er immer wieder Edvarda, die sechzehnjährige Tochter des schwerreichen Kaufmanns Mack.
Denn "Pan" ist naturgemäß auch die große Geschichte einer Sommerliebe, einer beidseitig sehr kapriziösen Leidenschaft. Edvarda und Glahn können nicht zueinander finden. Auf jede seiner Annäherungen und Liebesbeteuerungen folgt ihr Zurückweichen, auf jedes Zurückweichen die neue Lockung. Edvarda wartet zwar auf den Mann ihres Lebens. Der soll nach der Vorstellung des Vaters aber kein hergelaufener Leutnant oder Naturbursche sein, sondern ein standesgemäßer Herr. Als sich tatsächlich ein naturwissenschaftlernder Baron einstellt, gerät Glahn völlig außer sich. Schwere Eifersucht verstärkt seine Neigung zu wirren, selbstschädigenden Handlungen. Bei einer Bootsfahrt wirft er Edvardas Schuh ins Wasser, bei anderer Gelegenheit schießt er sich selbst in den Fuß, um so pittoresk humpeln zu können wie einer seiner Nebenbuhler.
All das, was zur Innenausstattung des sensiblen Menschen im Fin de Siècle gehört, die zerrütteten Nerven, die "Neurasthenie", findet sich in Hamsuns erotisch aufgeladenen Wäldern. Glahn pirscht mit dem "Tierblick", der ihm mehrfach von den Damen attestiert wird, zwischen den Bäumen umher, immer ist ein herumirrendes Mädchen in der Nähe. Dann gibt es noch die Frau eines Schmieds, mit der Glahn sich sexuell entschädigt für alle Kompliziertheiten Edvardas. Bis er diese Eva (sie heißt wirklich so) aus Versehen umbringt - eigentlich wollte er ja nur den "Baron" mit einem kunstvoll vom Berg gesprengten Steinschlag erledigen. Bösartige Anwandlungen sind diesem liebeskranken Waldgänger keineswegs fremd. Edvarda bittet ihn zum Abschied um seinen geliebten Hund Äsop; er erschießt das Tier und lässt ihr den Kadaver überbringen.
Aufregend ist Hamsuns Menschendarstellung. Es war das Ideal des realistischen Romans, die Figuren psychologisch durchsichtig zu machen. Ihre Motive durften nicht im Dunklen bleiben. In der Moderne wurden die literarischen Charaktere komplizierter, und die Erzähler mussten immer weiter ausholen, bis hin zu den analytischen Exzessen Prousts. Hamsun schlug einen anderen Weg ein. Nichts verachtete er mehr als die herkömmliche Seelenkunde, die für alles gute Gründe zu nennen weiß. Im Inneren seiner Figuren glüht kein psychologisches Lämpchen. "Ich träume von einer Literatur, bei deren Menschen die Inkonsequenz buchstäblich ein Grundzug ist", hat er einmal gesagt. "Ich werde meinen Helden lachen lassen, wenn rationale Menschen meinen, er müsste weinen."
"Pan" und "Hunger" setzen diese Devise um. Sie war für den Autor übrigens mehr als eine literarische Strategie. Als er nach 1945 wegen seiner Kollaboration mit den Nazis zur Rechenschaft gezogen wurde, sollte Hamsun dem Gerichtspsychiater seinen eigenen Charakter beschreiben. Er antworte, dass er Hunderte von Figuren geschaffen habe, die alle keinen "Charakter" hätten. Die seien mal so und mal so, unberechenbar. Und so sei er selbst auch. Hamsuns Werke verabschieden die Fiktion vom Charakter.
Der Reiz seiner Prosa besteht darin, dass sie nicht viel erklärt und immer ganz gegenwärtig ist, voller Stimmung und Poesie, voller Launen und humoristischer Bizarrerien. Da sind besondere Anforderungen an die Übersetzung gestellt. Ingeborg und Aldo Keel haben sie in ihrer Neuübersetzung anlässlich des hundertfünfzigsten Geburtstags in vielen Feinheiten und Details verbessert und präzisiert. Da hieß es zum Beispiel in der alten Fassung: "Es war ein Zug in der Luft, der Wind stand auf der Hütte, und ich konnte deutlich das Rascheln des Spielhahns hören, weit hinten auf den Höhen." Der Leser stolpert. Stehender Wind? Spielhahn? Hier nun sind die Irritationen beseitigt: "Ein schwaches Zittern lag in der Luft, der Wind wehte zur Hütte hinab, und ich konnte den Schrei des Auerhahns von weit oben deutlich hören." Wir danken dem Erfinder des Wortes "Kuboaa" fürs Lesevergnügen.
Knut Hamsun: "Hunger". Roman. Aus dem Norwegischen von Siegfried Weibel. Mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Claassen Verlag, Berlin 2009. 236 S., geb., 19,95 [Euro].
Knut Hamsun: "Pan". Roman. Aus dem Norwegischen übersetzt von Ingeborg und Aldo Keel. Mit einem Nachwort von Aldo Keel. Manesse Verlag, München 2009. 251 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main