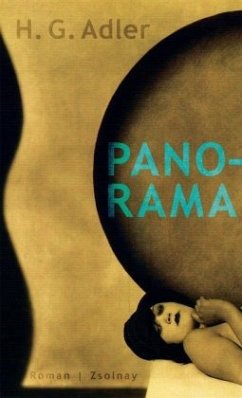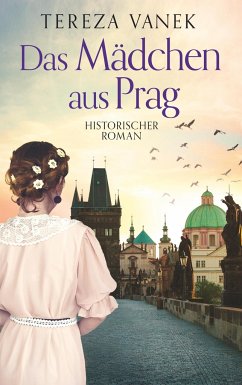H.G. Adler, der aus Prag stammende Schriftsteller und Freund von Elias Canetti aus gemeinsamen Tagen in der Emigration in London, erzählt in seinem 1948 entstandenen Roman "Panorama" in zehn Rundbildern das Leben von Josef Kramer, eine unverkennbare Projektion des Autors: die behütete Kindheit in Prag, ein böhmisches Dorf namens Umlowitz, das Freimaurerinstitut Dresden-Striesen, zuletzt die Zwangsarbeiterlager sowie die KZ Auschwitz und Langenstein-Zwieberge und schließlich Schloss Launceston in England. Die Wiederentdeckung von Adlers großem autobiografischem "Panorama" zum 100. Geburtstag im Jahr 2010, einem der letzten Romane der sogenannten Prager Schule.

Ein Leben im Guckkasten: Zum hundertsten Geburtstag des Schriftstellers H.G. Adler erscheint sein "Panorama" von 1948 in einer Neuausgabe. Nicht ohne Überraschung kann man einen Autor auf Augenhöhe mit der Weltliteratur entdecken - und einen heimlichen Humoristen.
Einer bestimmten Gruppe oder Schule wollte H. G. Adler, der am 2. Juli 1910 in Prag geboren wurde, niemals angehören (auch dem sogenannten Prager Kreis nicht), und sein folgenschwerer Entschluss, als Historiker und Romancier seine Erfahrungen in Theresienstadt, Auschwitz und Buchenwald in deutscher Sprache zu schreiben, hat sein Leben als Einzelgänger mitbestimmt. Ich weiß, wie ungehalten er später darüber war, wenn man ihn mit seinen Vornamen ansprechen wollte (denn SS-Sturmbannführer Hans Günther, unter dem Kommando Adolf Eichmanns, war einer der Gestapo-Organisatoren der böhmischen Judendeportationen), und auch in seinem Londoner Exil zögerte Adler keinen Augenblick, in deutscher Sprache fortzuschreiben. Er wollte nirgends zu Hause sein, auch in Israel nicht, und das Exil war ihm die gemäße und produktivste Lebensform.
Ursprünglich war Adler aus den Lagern in seine Geburtsstadt zurückgekehrt, sorgte dort mit dem tschechischen protestantischen Prediger Premysl Pitter heroisch für jüdische und deutsche Waisenkinder, aber in der parteipolitisch und chauvinistisch erregten Atmosphäre wollte er nicht bleiben, und sein Roman "Panorama", der erste gesammelte Blick auf seine Lebenserfahrungen, entstand binnen wenigen Wochen des Jahres 1948, sogleich nach seiner Ankunft in England.
Es dauerte dann zwanzig Jahre, ehe ein Verlag den Mut hatte, den Roman zu publizieren, und die deutsche Leserschaft hatte ihre Gründe, Adler damals eher als Historiker und Soziologen zu sehen, der eben die erste wissenschaftliche Untersuchung über Theresienstadt (1955) und ein Buch über die Juden in der deutschen Geschichte (1960) veröffentlicht hatte, und nicht als Schriftsteller, der die weithin sichtbaren Autoren der Gruppe 47 in die Schranken zu fordern vermochte.
Adler hat sich selbst dagegen gewehrt, sein "Panorama" ausschließlich als autobiographischen Roman zu charakterisieren. Er wollte ihn lieber als "autobiographisch gesättigt" interpretiert wissen. Er gibt uns jedenfalls die Chance, seine Erfahrungen in Alltag und Geschichte in zehn Guckkastenbildern zu begreifen, das ungeliebte Kind, von den Tanten eher als von den Eltern umhegt, die Jahre, in denen man ihn in die Schule eines südböhmischen Dorfes und dann als Dreizehnjährigen in die Zucht-und-Ordnung-Vorhölle einer Dresdner Erziehungsanstalt relegiert, aber auch einen friedlicheren Sommer als "Landfahrer" in einer jugendbewegten jüdischen Pfadfindergruppe, die ihre Zelte in den böhmischen Wäldern baut.
In seinen frühen Jahren als Student und Doktor der Philosophie (er verrät uns allerdings mit keinem Wort, dass er seine Dissertation über Klopstock und die Musik schrieb) hatte er es nicht leicht, seinen eigenen Weg zu finden; er widersteht der Verlockung, Mitglied eines Zirkels mystischer Amateure zu werden, der sich um einen berühmten tschechischen Künstler sammelt; als Hauslehrer in einer großbürgerlichen Familie steht er jeder vorgetäuschten Bildung ratlos gegenüber, und als Hilfskraft im "Prager Kulturhaus" (der berühmten "Urania") darf er, in einem bürokratischen Chaos, das letzte Rad am Wagen spielen.
Dann kommen die düsteren Zeiten; er wird, als Jude, zur Arbeit am Eisenbahnbau abkommandiert (immerhin sind die tschechischen Fachleute mit den Zwangsarbeitern noch solidarisch), aber in den Konzentrationslagern herrschen Hunger, Egoismus, Tod und Mord, und der Häftling schämt sich fast seiner stoischen "Bereitschaft zur Hinnahme", die sich von jedem törichten Fatalismus unterscheidet und keine Angst kennen will, denn die Angst "unterjocht und mordet, bevor noch ein Todesurteil den Menschen zur Vernichtung bestimmt". Das letzte Guckkastenbild zeigt den Flüchtling, der eben England erreicht hat und auf einem Ausflug aufs Land in Ruhe über sein bisheriges Leben nachdenken will - er hat allen Grund, auf die Gnade, die ihm zuteilgeworden, mit einem Akt der Freiheit zu antworten, und weiß nun deutlicher denn je, dass er "als Mensch nur bestehen kann", indem er sich nicht mehr "allein auf eine eigene Person" beschränkt.
Das intime und literaturhistorisch instruktive Nachwort, mit welchem Jeremy Adler, Sohn des Autors und Londoner Germanist, die neue Publikation begleitet, plädiert dafür, die heiteren Elemente des Romans nicht zu übersehen; und ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter und behaupte, dass es falsch wäre, über dem standhaften Melancholiker Adler den bedeutenden Humoristen zu übersehen, wie er in den Kapiteln über den Hauslehrer und das Prager Kulturhaus unverfälscht zutage tritt.
Die redselige Frau Börsenrätin, die den jungen Kandidaten für ihre Erziehungspläne einspannen will, ist eine komische Figur, gerade wenn sie behauptet, täglich in Spinozas Ethik zu lesen (sie hat eine in Leder gebundene Ausgabe auf ihrem Nachttisch liegen), und sich auf Freud und seine Schüler beruft, um den neuen, aber schon widerwilligen Hauslehrer zu bewegen, ihre Söhne vor "schwülen Gedanken" zu bewahren und die bedauernswerten Sprösslinge zu richtigen Philistern zu erziehen.
Im Kapitel über das Prager Kulturhaus verwandelt sich das Panorama vollends in ein groteskes Panoptikum; nicht so sehr kafkaeske Bürokratie als eher eine Marx-Brothers-Groteske: der geschwätzige Direktor Rumpler, der sich als "Goethe-reif" bezeichnet und alles selbst machen will, vom Kartenverkauf bis zu den Vorträgen über Kanarienvögel. Er wischt die Empfehlungen des jungen Philosophen, der angestellt werden möchte, mit einer Handbewegung vom Tisch: "Da halten Sie einen Haufen Empfehlungen in den Händen. Wie alt sind Sie? Ah, so, fünfundzwanzig. Wissen Sie, da hab' ich dem Schnitzler die besten Einfälle für seine Bücher gegeben, da hat er was gehabt und ist ein berühmter Mann geworden!"
Adlers Erfahrungen und Arbeiten sind eng mit Prager Schicksalen, den seinen und denen der anderen, verbunden, aber er ist durchaus kein Prager Patriot, wie der junge Rilke oder der jüngere Max Brod. Er liebt die Stifterschen Wälder und Berge (selbst im Lager schweift sein Blick zum Gebirgshorizont), nicht die verwirrende Großstadt mit ihren Nachtlokalen und dem "Saxophongedudel" und den staubigen Straßen, in denen die Autos "rasen" und "unendlich fremde Menschen hasten". Die Wälder sind fern, aber der Schriftsteller will nicht auf die Authentizität des gesprochenen Stadt-Idioms verzichten, das uns daran erinnert, mit wem wir es zu tun haben: besorgte Eltern, die ihre "Mimis" (aus dem zärtlichen tschechischen miminko) mit "Grießkasch" und "Powidl" füttern, junge Leute gehen ins "Bio", nicht ins Kino, und selbst der hochgebildete Kulturdirektor fragt: "No, was ist denn Bildung?"
Adlers Roman, als Lebensbuch epochaler Erfahrungen, hat die frühen Kritiker allzu oft dazu verleitet, die Inhalte hervorzuheben, das Sprachliche zu unterschätzen oder gar zu ignorieren - anstatt die Spannkraft seiner Sprachkraft zu bewundern, die von den komischen Monologen grotesker Figuren bis zu jenen Augenblicken in den Lagern reicht, in denen die Not auch die Syntax zerbricht und nur das nackte einzelne Wort bleibt. Hinter dem Stacheldraht beginnt "die Sprache zu kriechen", die Wörter sind "hart, gebellt", sie werden "hervorgestoßen", die Rede der Verlorenen "fließt nicht, sie deutet nur an oder packt, sonst sind es Schreie, gezückte Flammen, geschleuderte Stiche".
Allerdings drängt uns das wiederkehrende Motiv des Panoramas mit seiner Folge von Guckkastenbildern dazu, das starre und deskriptive Optische zu suchen oder, wie es die ersten Rezensenten taten, nach der Präzision des Details zu fragen oder ihren Überfluss zu beklagen. Die Einzelheiten der mannigfaltigen Lebenssituationen in Kindheit, Dorf, Jugend, Großstadt, Zwangsarbeit und Lager sind alle unverlierbar gegenwärtig, denn das ganze Buch ist kompromisslos in der Gegenwart geschrieben, und nichts ist durch ein distanzierendes und tröstliches "Es war einmal" in die Vergangenheit gerückt.
Mehr noch: Alles wird gesagt und gehört, die Menschen reden alle oder hören zu (wenn sie können), und wenn Josef, der zentrale Charakter, einmal ruht, nimmt sein anderes Ich das Wort und sagt uns seine geheimen Gedanken. Die Sprache oder eigentlich das Gesagte und Gehörte schwillt auf und ab, flutet mühelos über Absätze und Seiten, liebt das verbindende Komma, zögert mit einem Semikolon, und Schlusspunkte sind selten.
Panorama? Wir sind mit einem Male auf ein Experiment eingestimmt, das an Gertrude Steins Prosakunst erinnert, ohne an Deutlichkeit zu verlieren. Gleich hinter dem Guckloch spielt ein vielstimmiges Orchester, und nichts an feinen Flöten oder den Gewittern der Pauken geht verloren. H.G. Adler ist eben kein Prager provinzieller Eigenbrötler, wie viele glaubten, aber ein kunstbewusster Schriftsteller, der sich seine eigenen Methoden erfindet, auf der Höhe der Weltliteratur. Wir sind erst am Anfang, und in seinen Werken, ob Prosa, Lyrik oder Philosophie, gibt es noch vieles zu entdecken.
PETER DEMETZ
H. G. Adler: "Panorama". Roman in zehn Bildern. Mit einem Nachwort von Jeremy Adler. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2010. 623 S., geb., 27,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ein Jahrhundertwerk mit Vorbehalten erkennt Christoph Bartmann in diesem bereits 1968 und nun neu veröffentlichten autobiografischen Bildungsroman von H. G. Adler. Der Autor, Intellektueller aus der letzten Generation deutschprachiger Prager Juden, ein brillanter Erzähler und Essayist, wie Bartmann erklärt, und ein Fall für Spezialisten, lässt es substanziell richtig krachen, wenn er die Lebens- und Leidensstationen seines Helden (vom böhmischen Land über Auschwitz bis auf ein englisches Schloss) panoramatisch abläuft. Und so gern es der Rezensent auch sähe, bräche jetzt eine Adler-Renaissance los, so sehr vermisst er in diesem programmatischen Buch das Spielerische, das die einmal gewollte Idee und Form konterkarierende Element. In letzterem mit Elias Canettis Kritik übereinstimmend, findet Bartmann aber noch einen weiteren innerliterarischen Grund für eine gewisse das Publikum eventuell überfordernde Sperrigkeit. Mit seinen philosophischen Spekulationen über den Schöpfungsdualismus im Schlusskapitel, das muss auch Bartmann einräumen, schießt der zwiefach geniale Autor wohl doch übers Ziel hinaus.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Die Substanz dieses Buches ist wirklich reich, wie Elias Canetti schrieb: Sie umfasst ein Vierteljahrhundert des Schreckens, eine Lebensgeschichte, die zugleich die Geschichte einer Zeit und eines bürgerlichen Milieus ist, das untergegangen ist im Dritten Reich." Ulrich Rüdenauer, WDR
"Zu großer Form läuft Adler in den Bildern über mystische Sehnsüchte, die hysterisch-moderne Bürgerfamilie und das im Chaos aus Korruption, Unfähigkeit und Geschwafel untergehende Kulturhaus auf." Jörg Plath, Deutschlandradio
"Dieses einzigartige Buch gibt tiefe Einblicke nicht nur ins Wesen der Vernichtungsmaschinerie des Dritten Reichs und in die Umstände, die zur Entstehung dieser Maschinerie führten, sondern auch in die Unfähigkeit der Zeitgenossen, solche Bilder wahrzunehmen und zu verkraften."
Oleg Jurjew, Der Tagesspiegel, 19. Juni 2010
"H.G. Adler ist ein kunstbewusster Schriftsteller, der sich seine eigenen Methoden erfindet, auf der Höhe der Weltliteratur." Peter Demetz, FAZ, 2. Juli 2010
"Zu großer Form läuft Adler in den Bildern über mystische Sehnsüchte, die hysterisch-moderne Bürgerfamilie und das im Chaos aus Korruption, Unfähigkeit und Geschwafel untergehende Kulturhaus auf." Jörg Plath, Deutschlandradio
"Dieses einzigartige Buch gibt tiefe Einblicke nicht nur ins Wesen der Vernichtungsmaschinerie des Dritten Reichs und in die Umstände, die zur Entstehung dieser Maschinerie führten, sondern auch in die Unfähigkeit der Zeitgenossen, solche Bilder wahrzunehmen und zu verkraften."
Oleg Jurjew, Der Tagesspiegel, 19. Juni 2010
"H.G. Adler ist ein kunstbewusster Schriftsteller, der sich seine eigenen Methoden erfindet, auf der Höhe der Weltliteratur." Peter Demetz, FAZ, 2. Juli 2010