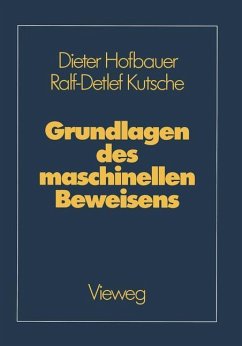Alan Turings Begriff "papermachines" in Besitz nehmend skizziert Dotzler eine Geschichte der Rechenmaschine von den ersten Anfängen bei Wilhelm Schickard (1623) bis zur letzten vorindustriellen mechanischen Rechenmaschine von Johann Helfrich Müller (1786). Diese technikgeschichtlich stets nur als "Vorgeschichte" gestreifte Periode wird hier als eigenständige Wissensformation vorgestellt, um so zu einer positiv umgrenzten Beschreibung der Machinae arithmeticae und ihres wissenschaftlich-technischen und literarischen Orts im 17. und 18. Jahrhundert zu kommen. Texte zur Mathematik und Logik, Physiologie und Physiognomik sowie zur Poetik und ausgewählte Beispiele aus Literatur und Dichtung werden zu diesem Zweck unter den Leitbegriffen der Kybernetik betrachtet: COMMUNICATION & CONTROL.

Bernhard Dotzlers originelle Ansichten über die Frühgeschichte der künstlichen Intelligenz
Otto Mayr, Technikhistoriker und ehemaliger Direktor des Deutschen Museums, hat vor neun Jahren angeregt, nach Zusammenhängen zwischen der technischen und der literarisch-philosophischen Verwendung des Konzepts der Selbstregulierung zu suchen. Das Ergebnis der Suche könnte ihm unbequem sein.
Was ist interessant am Gedanken der Selbstregulierung? Und was hat das Regelungsdenken mit Literatur zu tun oder darin zu suchen? Diese Fragen beantwortet Bernhard Dotzler auf 650 Seiten.
Wo treffen Technik und Literatur unmittelbar zusammen? Stellen wir uns die Denkmaschine des Raimundus Lullus vor, einige gegeneinander drehbare, konzentrische Holz- oder Metallscheiben: ein Theologe des 13. Jahrhunderts konnte damit die Kombinationen der Attribute Gottes mechanisch durchspielen. Mittelalterliche Textmaschinen standen unter einem äußeren Diktat: dem schweigsamen Diktat göttlicher Unausschöpflichkeit im Fall des Theologen, dem buchstäblichen Diktat des Vorlesers, wenn es sich um einen einfachen Schreiber oder Kopisten handelte.
Daß der Mensch aber gar keine Schreib-und Denkmaschine ist, sondern etwas ganz anderes, etwas Eigenes, Selbstbestimmtes, Autonomes, das ist die neuzeitliche Vorstellung. Der Mensch ist keine Schreibmaschine mehr, er ist jetzt ein Rechenautomat. Das Modell des Menschen, sein Sein oder die Form seines Daseins ist die arithmetische Maschine. Hier beginnt Dotzler. Aber er fängt vom Ende her an.
Der erste Teil seines Buchs erklärt uns, inwiefern die frühneuzeitlichen Rechenautomaten keine spätneuzeitlichen, das heißt modernen Rechenmaschinen waren. Machinae arithmeticae dürfen nicht mißverstanden werden als Vorläufer des Computers. Hier zeigt sich, was Otto Mayrs Frage nach der Selbstregulierung mit dem literarisch oder philosophisch artikulierten Selbstverständnis des Menschen zu tun hat. Sie ist nämlich identisch mit der Frage: Was ist unsere Moderne eigentlich, oder auch: Was war sie eigentlich?
Vormoderne Rechenautomaten kennen kein Regelungsdenken. Ihnen fehlt, wie Dotzler es bewußt verfremdend nennt, die Control-Komponente. Es handelt sich um Maschinen ohne Rückkoppelungsschleifen, ohne Schreib- und Lesefähigkeit, ohne Speicher- und Löschfunktion. Es sind Automaten mit unveränderlichem Programm, also ohne "Programmierung". Das "Neue" entsteht in ihnen durch Kombinatorik, ähnlich wie in der mittelalterlichen Denkmaschine. Nur ist an die Stelle göttlicher Unausschöpflichkeit eine diesseitige Unendlichkeit getreten, die das mechanistische Rechnen und die barocke Rhetorik in Gang hält.
Was ist das Wesen dieser frühneuzeitliche, selbstgenügsamen Automatik? Nehmen wir - als maschinelles Modell der barocken, mechanistischen Weltsicht - Wilhelm Schickards "Rechen Uhr" von 1623. Dreh- und Angelpunkt dieses Maschinentyps ist der Zehnerübertrag, für den eine mechanische Umsetzung gesucht wird. Diese Maschinen, wenn sie funktionieren, vollstrecken "nur" eine Automatik, die schon im Zahlbegriff selbst angelegt ist. Wie kann man große Zahlen schreiben und mit ihnen rechnen? Man kann unübersichtliche Strichlisten mit Bündelungen bilden (zum Beispiel "MDCXXIII"). Oder man kann sie nach dem Dezimalsystem in Zehner, Hunderter, Tausender und so weiter gliedern (zum Beispiel "1623"). Die Rechenmaschinen des Barock übersetzen nur diese effiziente Notationsform in eine noch effizientere Mechanik. "Das dekadische Zahlensystem an und für sich ist die Automatik der Machinae arithmeticae - bis ans Ende ihrer Epoche."
An diesem Ende wird Dotzlers Buch unbequem für Museumsdirektoren. Ungemütlich wird es für alle, die nicht streng genug unterscheiden zwischen den Epochen, für diejenigen, die überall Vorläufer sehen, Vorwegnahmen wittern, die sich Geschichte nur als mehr oder weniger durchgängige Entwicklung denken können. Zum Beispiel ist das dyadische Zahlensystem eines Leibniz nicht die Keimzelle der digitalen Revolution des zwanzigsten Jahrhunderts. Das museale Kontinuum, in dem einfach eine Maschinengestalt neben und nach der anderen erscheint, ist eine Fiktion. Dotzler tritt dieser Naivität mit der Strenge eines historischen Großinquisitors entgegen. Nichts an Leibniz weist auf unsere digitale Welt voraus. Alles erklärt sich bei ihm aus dem Zusammenhang des mechanistischen Denkens. Das dyadische System ist lediglich mechanisch besser handhabbar. "Denn bei jeder Zweizahl", so Leibniz, "ist es leicht, eine Einheit auf die folgende Stelle zu übertragen."
Die Geschichte ist demnach nicht ein Rundgang in einer der ordentlich getrennten Abteilungen eines Technischen Museums. Hier etwa die Rechenmaschinen, Konstruktions- und Schaltpläne von Schickard über Charles Babbage bis Konrad Zuse, Alan Turing, John von Neumann; dort die Kraftfahrzeuge vom Dampfwagen Nicolas Cugnots bis zur Apollo-Rakete: Die Museumsdidaktik sieht nicht vor, daß sich diese Wege zum Beispiel in der kybernetischen Steuerungseinheit der V2-Rakete kreuzen. Dem linear geordneten Museum setzt Dotzler deshalb das netzartig, "rhizomatisch" beschaffene "Archiv" entgegen.
Hier kommt die Literatur ins Spiel. Sie macht auch die synchronen Bezüge, nicht nur die zeitlichen Abfolgen anschaulich. Auf diese Wege und Abwege, die Knoten und Verzweigungen, die Wenn und Dann, auf die Kontingenzen und Rückkoppelungsschleifen will Dotzler eigentlich hinaus.
Denn mit dem Zufälligen beginnt die Moderne und damit der zweite Teil von Dotzlers Buch. Modernität bedeutet "flexible response". Modern sind Systeme, die sich in einer kontingenten Umwelt erhalten, die interne Rückkoppelungsmechanismen ausgebildet haben und deshalb anpassungsfähig sind. Sie agieren so geschmeidig wie der Fechtmeister (in einem Gleichnis des Soldaten und Literaten Heinrich von Kleist), der mit seinem Florett die Prankenhiebe eines Bären pariert. Auf der einen Seite steht der Geist, auf der anderen das ganz andere, heiße es nun Bär, Natur oder Kontingenz. Eine "prästabilierte Harmonie" gibt es hier nicht mehr; hier gibt es nur noch "Communication" - und das heißt letztlich den Kampf auf Leben und Tod. Es gibt nicht mehr "die" Ordnung, sondern nur noch vorübergehende, vergängliche, gebrechliche Zustände von Ordnung.
Modern in diesem seit der Zeit um 1800 gültigen Sinne sind Goethes Wilhelm-Meister-Romane, noch nicht Wielands Agathon; Novalis' "Blüthenstaub", nicht Gracians Handorakel; Kant, nicht Leibniz; Cabanis, nicht Condillac; Lichtenberg, nicht Locke. Modern sind, mit dem Wort des Computerpioniers Alan Turing, Dotzlers Halbgott, "Papiermaschinen". Um 1800 sind das menschliche Rechenmaschinen, die ein ganzes System sogenannter Erziehung mit Schiefertafeln und Wischlappen, Bleistiften und Radiergummis aufrüstet. Der Mensch wird durch und als Technik neu "erfunden". Als moderner Mensch liest er in lebenslänglichen Rückkoppelungsschleifen sein eigenes Geschriebenes, er löscht, schreibt neu, er verrechnet fortlaufend Vergangenheit und Gegenwart, unaufhörlich optimiert er sein literarisches "Programm".
Modern, allzu modern ist auch Dotzlers Prosa. Gemeint ist Verzicht auf einsträngige Argumentationslinien zugunsten einer offenen, zu offenen Verweisstruktur; seine puritanische Haltung, die jeden Anachronismus, jeden Rückfall hinter gewisse Standards eines Neuen Historismus unnachgiebig verfolgt; sein hohepriesterlicher Stil, der manches als bekannt voraussetzt, was nur wenigen Intellektualisten vertraut ist. Die vielen Seiten dieser "historischen Theorie des Programmierens" erschließt ein Index der Personen, Verfasser und literarischen Figuren. CHRISTOPH ALBRECHT
Bernhard J. Dotzler: "Papiermaschinen". Versuch über COMMUNICATION & CONTROL in Literatur und Technik. Akademie Verlag, Berlin 1996. 700 S., Abbildungen, gebunden, 98,- Mark.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main