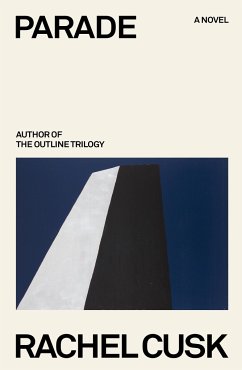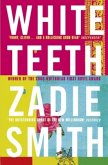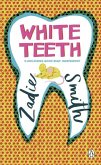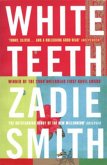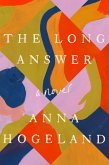"Midway through his life, the artist G begins to paint upside down. Eventually, he paints his wife upside down. He also makes her ugly. The paintings are a great success. In Paris, a woman is attacked by a stranger in the street. Her attacker flees, but not before turning around to contemplate her victim, like an artist stepping back from a canvas. At the age of twenty-two, the painter G leaves home for a new life in another country, far from the disapproval of her parents. Her paintings attract the disapproval of the man she later marries. When a mother dies, her children confront her legacy: the stories she told, the roles she assigned to them, the ways she withheld her love. Her death is a kind of freedom. Parade is a novel that demolishes the conventions of storytelling. It surges past the limits of identity, character, and plot to tell the story of G, an artist whose life contains many lives. Rachel Cusk is a writer and visionary like no other, who turns language upside down to show us our world as it really is."--
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Von Thomas David
Als Rachel Cusk im Frühjahr 2022 in einer Seitenstraße des Boulevard de Sébastopol von einer Frau angegriffen wurde, hatte sie den Schlüssel zu ihrem nächsten Buch noch nicht gefunden. Im Jahr zuvor war "Der andere Ort" erschienen, der Roman, den Cusk während des Lockdowns und der schweren Erkrankung ihres Ehemanns in ihrem Haus im nordenglischen Norfolk geschrieben hatte. Auf ihren Spaziergängen durch Paris war Cusk jetzt der Frage nachgegangen, ob es möglich sei, das malerische Verfahren der Inversion, das Georg Baselitz bekannt gemacht hatte, in die Literatur zu übertragen und in ihrem nächsten Roman gewissermaßen "auf dem Kopf" zu schreiben. Cusk hatte zuvor im Centre Pompidou eine Retrospektive gesehen, die Georg Baselitz gewidmet war.
Als ihr dann eine Fremde, die sie nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte, einen brutalen Schlag versetzte und Cusk zuerst nicht wusste, ob ihr ein Dachziegel auf den Kopf gefallen oder sie von einem Auto angefahren worden war, da schien nicht nur ihr Leben bedroht. Auch das Gefühl der Freiheit war durch den heimtückischen Angriff erschüttert, das Cusk erfüllt hatte, seitdem sie ihr Haus in Norfolk verkauft und dem verhassten England im Protest gegen Boris Johnson und den Brexit den Rücken gekehrt hatte. Sie fühlte sich orientierungslos und verwirrt.
"Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriff, was dieses persönliche Erlebnis für meinen neuen Roman bedeutete", sagt Rachel Cusk heute. Sie sitzt in ihrer Wohnung im eleganten, nördlich der Seine gelegenen Stadtviertel Marais am Esstisch. Links die großen, einem ruhigen Innenhof zugewandten Fenster. Rechts die offene Küche, in der Cusks Ehemann, der Maler Siemon Scamell-Katz, am Herd steht und ein Omelett zubereitet. Weiter hinten ein Sofa und ein kleiner runder Tisch. Farbige Teppiche auf altem Eichenfußboden. Spiegel, die dem lichtdurchfluteten Raum zusätzliche Helligkeit verleihen. An einer rauen, vom Putz befreiten Wand hängen zwei große abstrakte Gemälde, in denen Scamell-Katz die Erinnerungen an die dunkle Landschaft seiner Kindheit verarbeitet hat, geprägt von der brutalen Unterdrückung eigener Wünsche und Instinkte.
So wie Highfield, das Haus an der Küste Norfolks, das Cusk und Scamell-Katz gemeinsam entworfen und gestaltet hatten, ist auch diese im dritten Stock gelegene und sich über schmale Treppen bis unters Dach erstreckende Pariser Wohnung ein friedliches Refugium. Die stilvolle Ordnung, in der jedes ausgesuchte Detail einen festen Platz zu haben scheint, zeuge von der Einigung, so Cusk, die sie mit ihrem eher unordentlichen und chaotischen Ehemann getroffen hat. Die Ordnung, mit der sich Cusk umgibt, ist Ausdruck eines ihr anerzogenen Kontrollbedürfnisses - und ebenfalls das Relikt einer Kindheit.
Einem fremden Besucher offenbart Cusks Pariser Wohnung das gleiche kompromisslose Formbewusstsein, das auch die Romane der 1967 in Kanada geborenen Schriftstellerin auszeichnet. Ihre ersten Lebensjahre hatte sie in Los Angeles verbracht, bevor sie 1974 von ihren britischen Eltern ins englische Bury St Edmunds und in eine katholische Mädchenschule im nahen Cambridge verpflanzt wurde. Cusk fühlte sich noch als Studentin durch ihre Entwurzelung und Erziehung derart ausgelöscht, dass sie ihren ersten Roman "Saving Agnes" heimlich schrieb. Damit begann 1993 das Projekt ihrer künstlerischen Selbsterkundung. Die Stigmata von Scham und Schuld trägt sie bis heute.
In den vier Teilen ihres neuen Romans "Parade" beschreibt Cusk eine radikale Entwicklung weiblicher Selbstermächtigung. "Der Angriff auf der Straße", erklärt sie, "zeigte mir, dass Gewalt essenziell ist und eine Frau in der Lage sein muss, jemanden zu schlagen, bevor sie selbst zur Schöpferin werden kann." Das war der Schlüssel zum neuen Buch. Irgendwann sei ihr aufgegangen, dass es sich bei dem Angriff "um den Versuch einer Frau handeln könnte, sich auszudrücken". Cusk beschreibt, wie die davonlaufende Angreiferin noch einmal stehen bleibt und sich - "wie eine Künstlerin, die einen Schritt zurücktritt und ihr Werk bewundert" - nach der blutend am Boden kauernden Ich-Erzählerin umdreht. "Dies", so Cusk, "ist die erste Version einer Künstlerin, die einem ins Gesicht schlägt."
In "Parade" wechseln sich die Beobachtungen und Reflexionen der namenlosen Ich-Erzählerin ab mit fragmentarischen biographischen Skizzen verschiedener Künstlerinnen und Künstler namens "G", in denen neben Georg Baselitz etwa Louise Bourgeois, Paula Modersohn-Becker oder Filmemacher Éric Rohmer zu erkennen sind. Ein faszinierender Roman, der ähnlich wie ihre zwischen 2014 und 2018 erschienene "Outline"-Trilogie auch in formaler Hinsicht provoziert - und alle konventionellen Leseerwartungen an dekorative Beschreibungen von Figuren und Schauplätzen, an eine stringente Romanhandlung in den Wind schlägt. Cusk war schon beim Schreiben ihres Debütromans überzeugt, dass das Erfinden einer Handlung ihre literarische Selbsterkundung unterlaufen und sie damit einen ähnlichen Verrat an der Wahrheit begehen würde wie ihre Mutter - die das abhängige und unerfüllte Dasein als Hausfrau ihres Mannes kompensierte, indem sie die Familiengeschichte mit haltlosen Übertreibungen oder blanken Lügen ausschmückte.
Der verstörende Teil des neuen Romans, in dem Cusk über den Tod ihrer Mutter schreibt, zeugt vom gleichen, auf Authentizität und Wahrheit insistierenden Gestus, mit dem sich Cusk schon als Kind den mütterlichen Erfindungen widersetzt hat. Dieser Gestus hat dabei nichts von der Bekenntnishaftigkeit einer ausschließlich selbstbezogenen autofiktionalen Literatur. Der stille elterliche Hass und das strafende Schweigen, die das rebellische Kind auf sich zog, haben Cusk geprägt. Später fand das Widerhall in jener lähmenden öffentlichen Empörung, die 2001 Cusks schonungsloser Essay über ihre Mutterschaft und elf Jahre später ihr Memoir über das Scheitern ihrer zweiten Ehe auslösten. Das Image der "meistgehassten Schriftstellerin Großbritanniens" haftet ihrem Werk noch immer an.
In "Parade" hält die Ich-Erzählerin den rohen Angriff anfangs für ihre eigene Schuld und glaubt, er habe den Ursprung in ihr selbst. "Frauen können von dieser Gewalt nur dann verschont bleiben", so Cusk, "wenn sie eine Art falsches Selbst erschaffen, das diese Gewalt wie eine Stuntfrau stellvertretend für sie erfährt." Cusk trägt eine schwarze Bluse, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Auf dem Esstisch steht ein Blumenstrauß, auf dem Fensterbrett eine Plätzchenform in Gestalt des "Wanderers über dem Nebelmeer" - Cusk und Scamell-Katz haben sie von ihrem Besuch der Caspar-David-Friedrich-Ausstellung in Hamburg mitgebracht, als groteskes Beispiel für den Ausverkauf von Kunst. Als Cusk das Gurren der Taube hört, die draußen vor einem der geöffneten Fenster sitzt, steht sie auf, um sie zu verscheuchen. Cusk leidet an einer milden Form von Ornithophobie. Sie sagt: "Hau ab, Taube. Flieg niemals in mein Haus."
Dann erzählt sie von der Wohnung der Schauspielerin Kristin Scott-Thomas, in der sie und Scamell-Katz nach ihrem übereilten Umzug nach Paris vorübergehend Zuflucht fanden. Sie erzählt von einer anderen Wohnung im Marais, die sie nach kurzer Zeit wieder aufgegeben haben, um sich östlich von Limoges ein Haus auf dem Land zu kaufen. In ihrer jetzigen Pariser Wohnung leben die beiden erst seit vergangenem Herbst. Während Cusk einen Anruf ihrer Tochter Albertine entgegennimmt, kocht Scamell-Katz Kaffee - und erzählt von seinen neuen Bildern und vom Scheitern seines Versuchs, eine Pariser Stadtlandschaft zu malen, inspiriert von William Turners Londoner Ansichten. Nach dem Kaffee nimmt er seine Jacke, und wir fahren mit der Metro in sein Atelier im östlich von Paris gelegenen Montreuil.
"Als Rachel von der Frau angegriffen wurde, telefonierte sie gerade mit mir", erinnert sich Scamell-Katz. "Wir waren ins Gespräch vertieft, sodass sie der Schlag vollkommen unvorbereitet traf. Das Erlebnis war traumatisch, und sie meidet die Straße bis heute." Auf mehreren Staffeleien stehen die Bilder, an denen er gerade arbeitet: dünne Aluminiumtafeln, auf die Scamell-Katz zahlreiche hauchfeine Öl- und Lackschichten aufträgt, aus denen sich in einem langwierigen Prozess die besondere Wirkung seiner Gemälde ergibt. Auf einem Tisch die Schleifmaschine, mit der er die Spuren des Malprozesses von den Oberflächen der Bilder tilgt.
"Ich konnte mir anfangs nicht vorstellen, dass Rachel über dieses Erlebnis schreiben würde, weil es zu persönlich war und keine universelle Erfahrung zu repräsentieren schien - obwohl sich später herausstellte, dass die drogenabhängige Frau am Vortag eine andere Passantin auf gleiche Weise angegriffen hatte." In seinen alles Gegenständliche und Figurative transzendierenden Landschaftsdarstellungen, deren glatte Firnis keinen Pinselduktus, keine spezifische künstlerische Handschrift erkennen lässt, überwindet Scamell-Katz selbst die Subjektivität, um zu einer universellen Erfahrung des Erhabenen vorzudringen. Auf einer Staffelei ein weißes, von kaum wahrnehmbaren kreidigen Schatten durchzogenes älteres Bild: Scamell-Katz hat darauf seine Krankheit und die Todesnähe verarbeitet, die Ansicht von Leere und Nichts.
Seine Frau, erzählt er, habe sich gefragt, welche Bedeutung der Angriff hat und wie er sich als eine allgemeine menschliche Erfahrung erzählen lässt. "Es ist brillant, wie es Rachel in 'Parade' schließlich gelingt, das Persönliche zu überwinden und das eigene Erleben in etwas zu übersetzen, das eine allgemeine weibliche Erfahrung ausdrückt", sagt er. "Indem sie einen Weg gefunden hat, die Universalität zu verstehen, konnte sie die Gewalt des Angriffs sogar verzeihen. Die Gewalt dieses Angriffs", fügt er hinzu. "Denn ich glaube nicht, dass sie den Kritikern ihrer Bücher verzeiht." Das ablehnende Schweigen der Mutter, die Rachel Cusk noch auf dem Sterbebett ihre Liebe versagte und die Tochter mit der Ungewissheit über die wahre Natur ihrer Gefühle zurückließ, wirkt offenbar als Verletzung bis über den Tod hinaus.
"Als Kind hatte Siemon keinen freien Willen, und ich glaube, das hat ihn eine gewisse Demut gelehrt. Das Ungewöhnliche an seinen Bildern ist eine männliche Demut, von der ich glaube, dass sie der Schlüssel zur Zukunft ist." Erneuter Ortswechsel, Rachel Cusk sitzt inzwischen vor dem Café der Buchhandlung Shakespeare & Company an einem Tisch. Sie trägt ein weißes T-Shirt, eine große Sonnenbrille, die ihre Augen verbirgt. "Männliche Gewalt", behauptet Cusk, "ist viel unmittelbarer und destruktiver als die Gewalt von Frauen, und ich bin davon überzeugt, viele Männer haben in ihrem Innern ein Verlangen nach dieser Demut."
An den anderen Tischen vor allem Touristen, ein dicht gedrängtes Nebeneinander mit Blick auf Notre-Dame. Zwischen den Tischen zwei Tauben, die sich um Kuchenkrümel streiten. "Eines der Themen, das mich als Schriftstellerin immer interessiert hat und über das ich insbesondere in meinem letzten Roman geschrieben hatte", sagt Cusk, "ist die Tatsache, dass Frauen männliche Werte übernommen haben und voller männlicher Wahrnehmungen sind, weil sie sich Kunst von Männern angesehen oder die Bücher von Männern gelesen haben." In "Parade" erzählt sie von der Emanzipation einer authentischen weiblichen Stimme, von der künstlerischen Befreiung aus der männlichen Dominanz. "Die Frage ist, wie Frauen zu ihrer eigenen Wahrnehmung finden." Der brutale Schlag, den ihr die Angreiferin auf offener Straße versetzte, war ein Anfang.
Rachel Cusk, "Parade". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonné. Suhrkamp Verlag, 171 Seiten, 25 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.