Nicht lieferbar
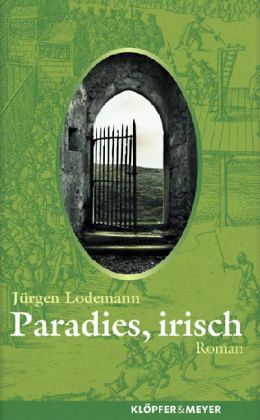
Paradies, irisch
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Dieser Roman erzählt den denkwürdigen historischen Fall eines irischen Wirtschaftswunders um 1550. Vor 32 Jahren unter dem Titel "Lynch" veröffentlicht, ist nach jahrelangen Recherchen erneuert und erweitert um wesentliche Fundstücke.
"Paradies, irisch" erzählt den verblüffend aktuellen Fall einer frühen Versöhnung in der Terrorgeschichte zwischen Engländern und Iren, Katholiken und Protestanten - unter dem weitsichtigen Bürgermeister Lynch, von dem es heißt, er sei der unselige Namensgeber für eine Perversion der Justiz.
"Paradies, irisch" erzählt den verblüffend aktuellen Fall einer frühen Versöhnung in der Terrorgeschichte zwischen Engländern und Iren, Katholiken und Protestanten - unter dem weitsichtigen Bürgermeister Lynch, von dem es heißt, er sei der unselige Namensgeber für eine Perversion der Justiz.




