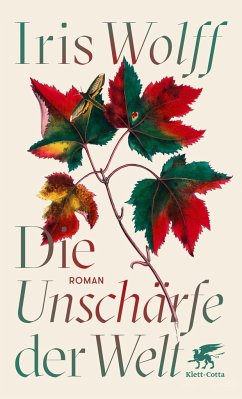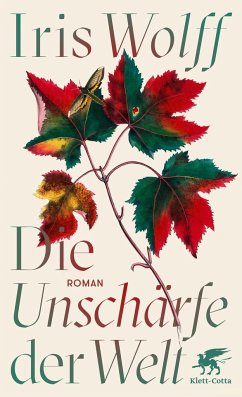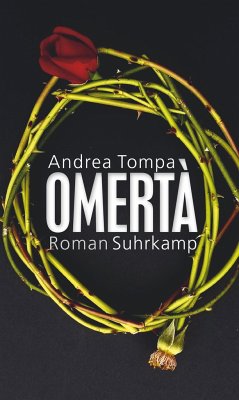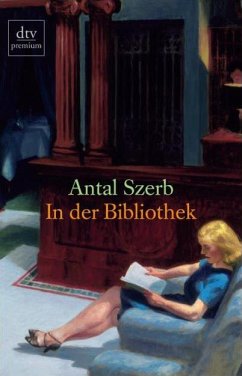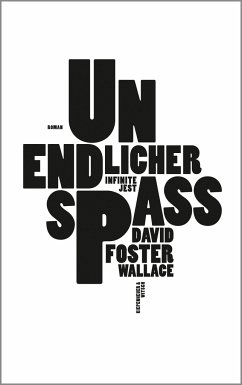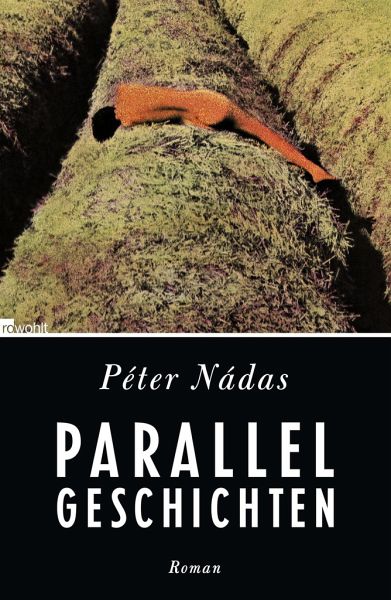
Parallelgeschichten
Roman. Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, Kategorie Übersetzung 2012 (Christina Viragh)
Übersetzung: Viragh, Christina
Versandkostenfrei!
Versandfertig in ca. 2 Wochen
39,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Zwanzig Jahre nach seinem international gefeierten Buch der Erinnerung legt Péter Nádas sein Opus maximum vor. Als die Parallelgeschichten 2005 in Ungarn erschienen, wurden sie als ein «Krieg und Frieden des 21. Jahrhunderts» begrüßt.1989, im Jahr des Mauerfalls, findet der Student Döhring beim Joggen im Berliner Tiergarten eine Leiche. Mit dieser kriminalistischen Szene beginnt der Roman, eröffnet zugleich aber auch die weitgespannte Suche nach dem düsteren Geheimnis einer Familie. Es ist die Geschichte der Budapester Familie Demén und ihrer Freunde, deren persönliche Schicksale mi...
Zwanzig Jahre nach seinem international gefeierten Buch der Erinnerung legt Péter Nádas sein Opus maximum vor. Als die Parallelgeschichten 2005 in Ungarn erschienen, wurden sie als ein «Krieg und Frieden des 21. Jahrhunderts» begrüßt.
1989, im Jahr des Mauerfalls, findet der Student Döhring beim Joggen im Berliner Tiergarten eine Leiche. Mit dieser kriminalistischen Szene beginnt der Roman, eröffnet zugleich aber auch die weitgespannte Suche nach dem düsteren Geheimnis einer Familie. Es ist die Geschichte der Budapester Familie Demén und ihrer Freunde, deren persönliche Schicksale mit der ungarischen und deutschen Vergangenheit verknüpft werden. Die historischen Markierungen sind die ungarische Revolution 1956, die nachrevolutionäre Zeit, der ungarische Nationalfeiertag am 15. März 1961 und, rückblickend, die Deportation der ungarischen Juden 1944/45 und die Vorkriegszeit der dreißiger Jahre in Berlin.
Der Roman entwirft ein Panorama europäischer Geschichte, in einer überwältigenden Fülle von Geschichten, die keine realistische Konstruktion zu einer Story vereinen könnte. Die eine große Metaerzählung des Romans jedoch bilden die Geschichten der Körper, die für Nádas zum Schauplatz der Ereignisse werden. Der
männliche und weibliche Körper und seine Sexualität prägen die Lebenswirklichkeit der Personen, sie sind das «glühende Magma», das «in der Tiefe ihrer Seele oder ihres Geistes ruhende Zündmaterial», das die Parallelgeschichten zur Explosion bringt.
Aufgrund seines analytischen Scharfblicks und der Kraft seiner Personengestaltung stellt die internationale Kritik Péter Nádas neben Proust. Wenn dessen großer Roman am Beginn einer literarischen Moderne steht, dann mag diese in den Parallelgeschichten ihre Vollendung finden.
1989, im Jahr des Mauerfalls, findet der Student Döhring beim Joggen im Berliner Tiergarten eine Leiche. Mit dieser kriminalistischen Szene beginnt der Roman, eröffnet zugleich aber auch die weitgespannte Suche nach dem düsteren Geheimnis einer Familie. Es ist die Geschichte der Budapester Familie Demén und ihrer Freunde, deren persönliche Schicksale mit der ungarischen und deutschen Vergangenheit verknüpft werden. Die historischen Markierungen sind die ungarische Revolution 1956, die nachrevolutionäre Zeit, der ungarische Nationalfeiertag am 15. März 1961 und, rückblickend, die Deportation der ungarischen Juden 1944/45 und die Vorkriegszeit der dreißiger Jahre in Berlin.
Der Roman entwirft ein Panorama europäischer Geschichte, in einer überwältigenden Fülle von Geschichten, die keine realistische Konstruktion zu einer Story vereinen könnte. Die eine große Metaerzählung des Romans jedoch bilden die Geschichten der Körper, die für Nádas zum Schauplatz der Ereignisse werden. Der
männliche und weibliche Körper und seine Sexualität prägen die Lebenswirklichkeit der Personen, sie sind das «glühende Magma», das «in der Tiefe ihrer Seele oder ihres Geistes ruhende Zündmaterial», das die Parallelgeschichten zur Explosion bringt.
Aufgrund seines analytischen Scharfblicks und der Kraft seiner Personengestaltung stellt die internationale Kritik Péter Nádas neben Proust. Wenn dessen großer Roman am Beginn einer literarischen Moderne steht, dann mag diese in den Parallelgeschichten ihre Vollendung finden.