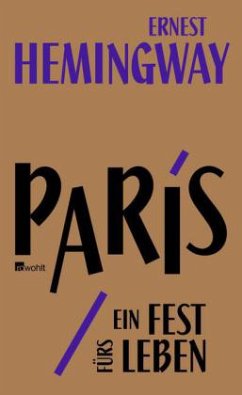Als Hemingway im Jahre 1956 mit seiner Frau Mary im Hotel Ritz in Paris abstieg, ließ er sich aus dem Keller die Koffer holen, die dort seit mehr als zwanzig Jahren auf ihn warteten. Sie enthielten seine Tagebücher und Aufzeichnungen aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als er Korrespondent einer kanadischen Zeitung in Paris war. Für Hemingway waren es glückliche Zeiten, als er an der Seine angelte, bescheidene Gewinne beim Pferderennen in Champagner umsetzte, sich mit Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound und F. Scott Fitzgerald traf - und im übrigen lebte, wie Gott in Frankreich zu leben pflegt.

Herabsetzung, Lebens- und Liebeskunst: Ernest Hemingways "Paris - Ein Fest fürs Leben", erstmals in der Urfassung und glänzend neu übersetzt.
Von Wolfgang Schneider
Dieses Buch ist nicht nur ein herausragendes literarisches Werk, sondern auch ein Schlüsseltext zur Kulturgeschichte der Moderne. Das legendäre Paris der zwanziger Jahre mit seiner Kultur der amerikanischen Expats, denen der starke Dollar ein bequemes Leben der Boheme ermöglichte, ist in dieser Prosa zu besichtigen, wie in klaren Bernstein gebannt. Und es ist ein grandioses Porträt des Künstlers als jungen Mann. Gerade hat er die Poetik der radikalen Verknappung erfunden. Er bummelt die Seine entlang, sieht den Anglern zu, und immer arbeiten die Geschichten in ihm. In schön hemdsärmeligen Dialogen werden Fragen des Handwerks besprochen.
Auf den Spuren Hamsuns inszeniert Hemingway seine Hungerjahre in der Großstadt. In Wahrheit waren seine Verhältnisse nicht ganz so ungesichert. Hadley, seine erste Frau, verfügte über Geldzuflüsse. Es war also keineswegs zwingend, dass sich das Paar beim ersten Parisaufenthalt in einer Art Slum einmietete. Später wohnten sie auf dem Hinterhof eines Sägewerks - und Hemingway ging zum Schreiben ins Café. Das Geld investierte er lieber in diverse sportliche Leidenschaften und Pferdewetten. Er boxt mit jedem, der es mit ihm aufnimmt, spielt Tennis mit Ezra Pound, firmiert als Leibwächter für den fragilen James Joyce. Beim Sport liebt er den Geruch von Schweiß und Tod.
Sei einfach, sei wahr - das ist Hemingways stilistisches Mantra. Wenn das mit der Wahrheit bloß immer so einfach wäre. Da schildert er Paris als brodelndes Laboratorium der Moderne - und findet für die eigene Tätigkeit nur Vergleiche aus biblischer Urzeit: "Ich hatte bereits gelernt, den Brunnen meines Schreibens nie zu erschöpfen, sondern stets aufzuhören, wenn im tiefen Teil des Brunnens noch etwas übrig war, und ihn über Nacht von den Quellen, die ihn speisten, wieder füllen zu lassen." Wenn das nicht von Hemingway wäre, könnte es auch von Coelho sein.
Aber Hemingway ist kein dürrer Simplizitätsschreiber; anderswo findet man atemberaubende Metaphern und Vergleiche. Kriegskrüppel sitzen in den Cafés, und er sinniert über die Kunst der Gesichts-Chirurgie: "Ein in großem Umfang wiederhergestelltes Gesicht hatte immer etwas Schillerndes oder Glänzendes, fast so wie eine guteingefahrene Skipiste" - das erinnert in der Übertragung von Detailwahrnehmungen in einen anderen Zusammenhang an das Verfahren Prousts, den er im Übrigen verachtet. Und nicht nur ihn. Über Ford Maddox Ford, den Kollegen und Förderer, heißt es: "Ford saß aufrecht wie ein großer keuchender Fisch und hatte einen Atem, der schlimmer stank als die Fontäne eines Wals."
Höhepunkt ist das über mehrere Kapitel gehende Porträt von Zelda und Scott Fitzgerald. Schon dessen erste Beschreibung ist herabsetzend, betont den "feinen" Mund, "der bei einem Mädchen der Mund einer Schönheit gewesen wäre", und die allzu kurzen Beine. Zelda wird als vergnügungssüchtige Frau geschildert, die aus Eifersucht ständig die Arbeit ihres Mannes sabotiert. Und dann kommt die ungeheuerliche Szene, in der Scott sich dem Alpha-Mann anvertraut: Zelda sei unzufrieden mit der Größe seines Geschlechtsteils. Hemingway, der Arztsohn, bittet Fitzgerald "in die Praxis" (nicht mehr, wie in der alten Übersetzung, "ins Büro"), also auf die Toilette des Restaurants, um die Sache in Augenschein zu nehmen. Und geht mit Klein-Fitzgerald dann noch hinüber in den Louvre, um ihn anhand der Statuen Penisgrößen zu erläutern. Wieso diese entwürdigende Darstellung des Freundes, dessen "Gatsby" er oft gelobt hatte? In den späten fünfziger Jahren wurde der früh verstorbene Fitzgerald wiederentdeckt, während Hemingway nach dem Nobelpreis stagnierte; hier versucht er, den anschwellenden Ruhm des Rivalen nach Kräften zu beschädigen.
Diese revidierte Ausgabe, die als "Ur-Fassung" daherkommt, folgt dem beinahe fertigen Manuskript, wie es Hemingway bei seinem Selbstmord im Juli 1961 hinterließ. Die Edition von Mary Hemingway und Harry Brague aus dem Jahr 1964 hat die Reihenfolge der Kapitel geändert, einige Absätze aus dem Buch herausgenommen und es im Gegenzug mit fragmentarischem oder gestrichenem Text-Material angereichert, darunter Passagen, die Hemingways zweite Ehefrau Pauline Pfeiffer in ungünstiges Licht rücken. Mit der "Reichen", die sich in seinem Leben "einnistet", betrügt er Hadley. Pauline erscheint als Zerstörerin der Liebe. Herausgeber und Enkel Seán Hemingway will nun seine Mutter Pauline rehabilitieren. Im Kapitel "Der Lotsenfisch und die Reichen", das jetzt unter den zusätzlichen Pariser Skizzen zu lesen ist, schildert Hemingway den Frauenwechsel differenzierter und nimmt den Großteil der Schuld auf sich.
Beim Meister des Weglassens weckt alles Weggelassene große Erwartungen. So genießt man ein paar schöne Outtakes, ein fachmännisches Kapitel über einen Boxkampf und einen verspielt-verliebten Dialog mit Hadley über Frisuren. Amüsant auch ein Kapitel über eine Autofahrt in Philadelphia mit den Fitzgeralds. Zum Besten gehört das Kapitel "Winter in Schruns", das um gestrichene Passagen ergänzt wurde. Dank der Inflation können die Amerikaner nicht nur billig in Paris leben, sondern sich auch nachhaltige Skiferien in den Alpen leisten.
Eine auffallende Änderung der Neuausgabe besteht in der gelegentlichen Verwendung der Selbstanrede in "Du"-Form, wo bisher ein blasses "man" zu lesen war: "Als du Mahlzeiten auslassen musstest, nachdem du den Journalismus aufgegeben hattest und nichts zustande brachtest, was jemand in Amerika kaufen wollte . . ." Der Eindruck ist zwiespältig. Zwar wird bei diesen Passagen nun der Charakter der intimen poetischen Erinnerungsarbeit verstärkt, aber Verbformen wie "du heuertest" oder "du verheiztest" haben nicht gerade Parlando-Charakter.
Trotzdem ist der Gewinn dieser Ausgabe vor allem die frische, luftige Neuübersetzung von Werner Schmitz. Hemingways Stil ist bei aller Einfachheit ja so schwer zu übertragen wie Lyrik; und die alte Übersetzung enthielt manchen Stolperstein - "Hasardspiel mit Pferden" zum Beispiel. Da steht jetzt einfach "Pferdewetten". Und Katherine Mansfields Geschichten lesen sich nicht mehr wie "Fastbier", sondern "wie Dünnbier".
Eines der auratischen Wörter Hemingways ist "wunderbar". "Die Forellen waren einfach wunderbar", Miss Stein leiht ihm "diese wunderbare Geschichte von Jack the Ripper", und über Dostojewski heißt es: "Seine Heiligen sind wunderbar." Das eigentlich nichtssagende Wort hat etwas mit der Essenz des Lebens zu tun, mit einfachen, unverfälschten Genüssen, mit den wahren und guten Dingen. Bei Hemingway, und nur bei ihm, lässt man sich diese Manier gefallen. An einer Stelle beschreibt er, wie er endlich Geld für eine Geschichte bekommt und erst einmal etwas essen geht. Die einfache Sinnlichkeit des Vorgangs wird zum literarischen Ereignis: "Das Bier war sehr kalt und trank sich wunderbar. Die pommes à l'huile waren fest und mariniert und das Olivenöl köstlich. Ich mahlte schwarzen Pfeffer auf die Kartoffeln und tränkte das Brot mit Olivenöl. Nach dem ersten tiefen Schluck Bier trank und aß ich sehr langsam." Das ist ganz einfach: wunderbar.
Ernest Hemingway: "Paris - Ein Fest fürs Leben". Die Urfassung.
Aus dem Englischen von Werner Schmitz. Rowohlt Verlag, Reinbek 2011. 316 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Pünktlich zu Ernest Hemingways 50. Todestag liegt - mal wieder - eine Neuausgabe der unvollendeten Memoiren "Paris - Ein Fest fürs Leben" vor und Rezensent Thomas Hermann ist wider Erwarten begeistert. Denn mit dieser ausgezeichnet recherchierten Ausgabe trage der Herausgeber Sean Hemingway, Enkel des Autors, zu einem differenzierten Hemingway-Bild bei. Während Ernests Witwe Mary deutliche, durch ihre intime Kenntnis des Autors gerechtfertigte Veränderungen in ihrer Edition des Fragmentes vornahm, setze Sean vor allem auf die Authentizität der von ihm herausgegebenen "Urfassung" und komme damit dem Nachlass seines Großvaters bedeutend näher. Für den Rezensenten liegt genau darin deren Mehrwert: dank bisher unveröffentlichter Textpassagen erfahre man nun beispielsweise von Hemingways Skrupeln den Text zu publizieren - er hatte seine Kollegen und Freunde nicht gerade vorteilhaft porträtiert. Und durch die hier veröffentlichten transsexuellen Fantasien entdeckt Hermann die Widersprüchlichkeit des Autors hinter seinem chauvinistischen Helden-Image. Ausdrücklich lobt der Rezensent die Übersetzung von Werner Schmitz, der im Gegensatz zu seiner Vorgängerin auf überflüssige Manierismen verzichte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Dieses Buch ist nicht nur ein herausragendes literarisches Werk, sondern auch ein Schlüsseltext zur Kulturgeschichte der Moderne. FAZ.NET