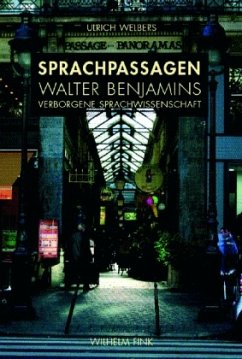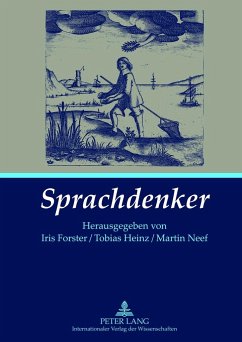Nicht lieferbar

Pariser Orientlektüren
Zu Wilhelm von Humboldts Theorie der Schrift. Nebst der Erstedition des Briefwechsels zwischen Wilhelm von Humboldt und Jean-Francois Champollion le jeune (1824-1827)
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Der bedeutende Schriftphilosoph Jacques Derrida hat Wilhelm von Humboldts Theorie der Schrift nicht reflektiert oder uns zumindest nichts darüber mitgeteilt. Das hat nicht nur zum Hegel-fixierten und elliptischen Charakter der Grammatologie-Debatte beigetragen, sondern auch zur weitgehenden Unkenntnis der humboldtschen Schriftreflexion. Diese erschließt nun zum ersten Mal systematisch die vorliegende Arbeit. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Schrift für Humboldts Sprachdenken ist es erstaunlich, dass die Forschung seiner Schrifttheorie noch nicht umfassend Rechnung getragen hat. Ein Grun...
Der bedeutende Schriftphilosoph Jacques Derrida hat Wilhelm von Humboldts Theorie der Schrift nicht reflektiert oder uns zumindest nichts darüber mitgeteilt. Das hat nicht nur zum Hegel-fixierten und elliptischen Charakter der Grammatologie-Debatte beigetragen, sondern auch zur weitgehenden Unkenntnis der humboldtschen Schriftreflexion. Diese erschließt nun zum ersten Mal systematisch die vorliegende Arbeit. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Schrift für Humboldts Sprachdenken ist es erstaunlich, dass die Forschung seiner Schrifttheorie noch nicht umfassend Rechnung getragen hat. Ein Grund hierfür liegt sicher im Konsens über die Zentralität des Begriffs der Rede für Humboldts Sprachanthropologie. Schrift ist für Humboldt aber nicht einfach Abbild der Sprache, sondern das materiale Äquivalent eines formalen Verfahrens der Begriffskonstitution und reicht somit in den tiefsten Bereich seines Sprachbegriffs hinein. Folgenschwerer noch war die lange Unkenntnis des Nachlasses. Weil es nur wenige Texte von Humboldt zur Schriftthematik gibt, zeigt sich die Ausprägung seiner Theorie nämlich erst im Wechselspiel dieser Texte mit der unedierten Korrespondenz. Das gilt vor allem für Humboldts Briefwechsel mit Forschern in Paris, insbesondere mit dem Hieroglyphen-Entzifferer Jean-François Champollion, der hier zum ersten Mal zusammenhängend ediert wird. Insofern als es vor allem außereuropäische Schriftsysteme sind, an denen Humboldt seine Theorie entfaltet, stellt sich schließlich die Frage nach Humboldts Platz im europäischen Orientalismus.