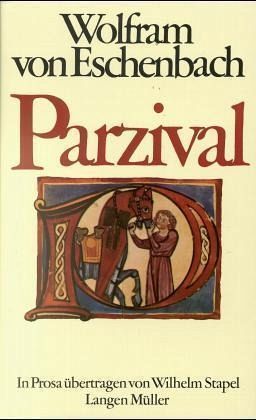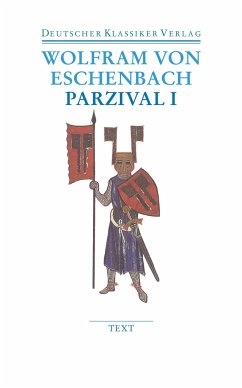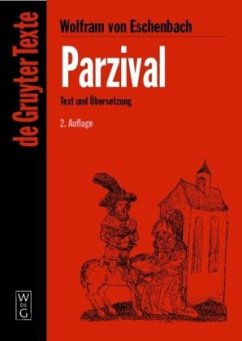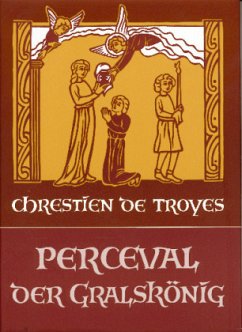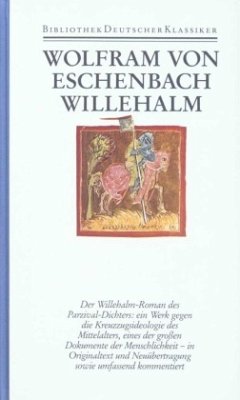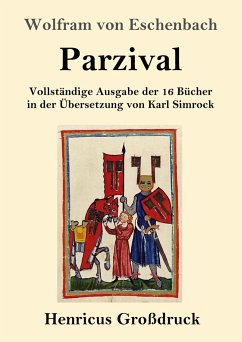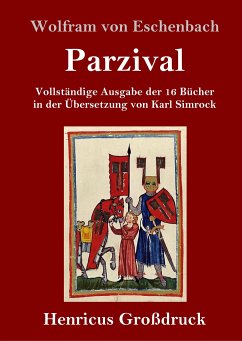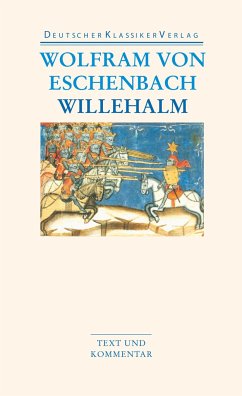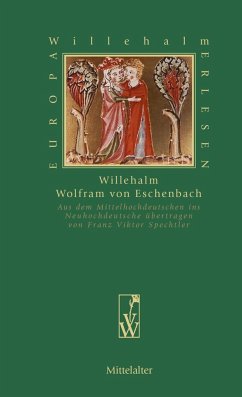PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Parzival
Wolfram von Eschenbach, um 1200. Der Epiker und Lyriker bezeichnet sich selbst als Ritter, die Herkunft aus Eschenbach (heute Wolframs-Eschenbach) südöstlich von Ansbach in Franken gilt als wahrscheinlich. In seinen Werken nimmt er u. a. Bezug auf die Herren von Dürne (Sitz: Burg Wildenberg bei Amorbach), auf die Grafen von Wertheim und v. a. Landgraf Hermann I. v. Thüringen, die zu seinen Mäzenen gehörten. W. war in erster Linie Epiker, wenn ihn auch seine Tagelieder als Lyriker von Rang ausweisen.

Produktdetails
- Verlag: LANGEN/MÜLLER
- 29. Aufl.
- Seitenzahl: 443
- Deutsch
- Abmessung: 212mm x 136mm x 43mm
- Gewicht: 560g
- ISBN-13: 9783784418155
- ISBN-10: 3784418155
- Artikelnr.: 00647774
Herstellerkennzeichnung
LangenMueller Verlag
Pfizerstraße 5-7
70184 Stuttgart
info@herbig.net
"Mit dieser [...] Konzentration auf den Text des Sangallensis ist dem Herausgeber ein Kabinettstück editorischer Kunst gelungen."Michael Stolz in: Zeitschrift für deutsche Philologie 1/2011
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Tilman Spreckelsen entdeckt viel Zeitloses in Wolfram von Eschenbachs Roman. Brücken vom Mittelalter in unsere Zeit sind für ihn Liebesleid und eine aus den Fugen geratene Welt. Wenn der Untergangsstimmung im Artus-Reich im Text die höfische Erziehung in ihrer Aporie gegenübergestellt wird, fragt Spreckelsen nach der Rolle der höfischen Gesellschaft insgesamt. Und auch das Konzept der Rache wird hinterfragt, sodass der Rezensent überlegt, ob die Welt nicht besser wäre, würde nur der "Parzival" mehr gelesen. Gelegenheit, meint er, bietet diese metrische, doch weitgehend ungereimte Neuübertragung von Franz Viktor Spechtler, der der Rezensent allerdings die ältere von Dieter Kühn in vieler Hinsicht vorzieht, und die er mitunter dunkler findet als die Vorlage.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Wie Metallspäne nach dem Magneten richten sich alle auf ihn (Rolf Boysen) und das literarische Opus aus."
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für