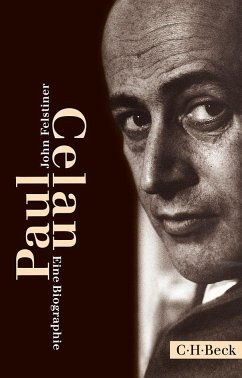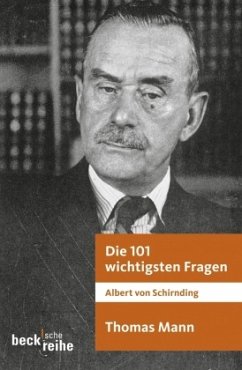Nicht lieferbar
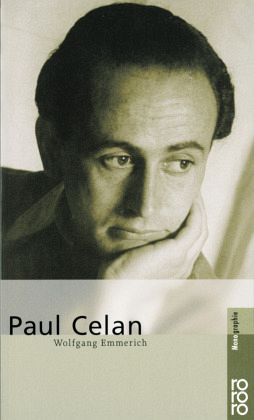
Paul Celan
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Paul Celan, 1920 in Czernowitz/Bukowina geboren, 1970 in Paris durch Selbstmord aus dem Leben gegangen, gilt heute als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts. Mit dem Bekanntwerden der "Todesfuge" setzte 1952 sein Ruhm ein. Der nazistische Massenmord an den Juden, dem auch Celans Eltern zum Opfer fielen, war das Thema schon dieses frühen Gedichts und blieb auf Lebenszeit das Zentrum des gesamten literarischen Werks.