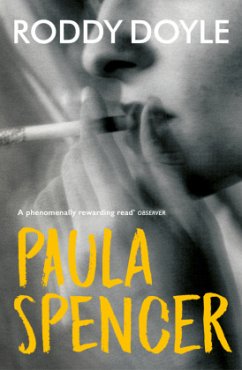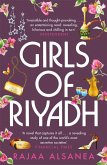Sie ist die irische Jedefrau und der Schrecken der Sozialarbeiter: Roddy Doyle erzählt in seinem Roman "Paula Spencer" vom inneren Drama einer trockenen Alkoholikerin.
Sucht lässt sich gut ins Bild setzen. Was wäre das Kino ohne all die angeschlagenen Männer und Frauen mit der Flasche in der Hand. Auch das Zittern und die Krämpfe des Entzugs haben zu beeindruckenden Filmen geführt. Man denke an Günter Lamprechts große Schlotter-Rolle in "Rückfälle". Der trockene Alkoholiker dagegen hat nichts Anschauliches in der Hand, höchstens Wasser, um jedes Durstgefühl im Ansatz zu bekämpfen. Seine Leistung ist ein ständiges Niederringen der Versuchung, ein still-heroisches Nicht-Tun - keine ergiebige Grundlage für filmische Darstellung. Der Roman aber, mit seinem Vorteil der Innenweltgestaltung, ist das ideale Medium für das innere Drama des Trinkers, der nicht mehr trinkt.
Roddy Doyle hat mit "Paula Spencer" einen Roman über eine solche Frau geschrieben. Man kennt Paula aus dem Roman "Die Frau, die gegen Türen rannte" (1997) - ein Buch der Verwahrlosung und der häuslichen Gewalt, ein furioser Verzweiflungsmonolog. Paula Spencer war der Schrecken der Sozialarbeiter: eine saufende Unterschichtmutter, die von ihrem kriminellen Mann ständig verprügelt wurde. Keine Figur mit Zukunft, wie es schien. Ein gutes Jahrzehnt später ist Paula nun wieder da, inzwischen achtundvierzig, und allein der Titel des Romans kündet von neuem Selbstbewusstsein. Zu Beginn ist Paula seit vier Monaten eine Ex-Trinkerin, ihr Ex-Mann weilt nicht mehr unter den Lebenden; bei einem Raubüberfall wurde er zum Mörder und dann selbst von der Polizei erschossen. Und Paulas ältester Sohn John Paul ist inzwischen ein Ex-Junkie. Die Zeichen stehen auf Genesung.
Das ist eine faszinierende Perspektive, positiv, aber unkitschig. Paulas Sehnsucht richtet sich auf das vermeintlich Selbstverständliche, sie ringt um Normalität. Eine Suppe zum Beispiel ist nur selten ein Ereignis von zwingendem literarischen Nährwert. Aber wenn die Trinkerin nach Jahren, in denen sie die Versorgung ihrer Kinder vernachlässigte, nun für alle eine Gemüsesuppe kocht und dabei nicht ganz zu Unrecht vom Gefühl beseelt ist, etwas Wunderbares zu vollbringen - dann ist das auch in Romanen eine große Szene. Was für die meisten Menschen bloß beiläufiger Alltag ist, ein Abend mit Freunden, der mal nicht im Rausch endet, ein Handy in Betrieb nehmen, ein paar Informationen aus dem Internet saugen, sich ein bisschen in aktueller Rockmusik auskennen - all das eignet sich Paula an wie neue Kulturtechniken. Durch die verfremdende Paula-Perspektive wirkt das Gewöhnliche kostbar.
Paula ist Putzfrau. Sie nimmt den Leser mit auf ihre Jobs, in die Wohnungen der Mittelklasse und einmal auch auf ein Konzert der White Stripes, wo sie den Müll der Fans wegschafft. Die Knochen tun ihr weh, es ist nicht nur die zermürbende Schufterei für wenig Geld, es sind auch die Nachwirkungen von Charlos Schlägen, die es umsonst gab. Noch mehr aber schmerzt das Schuldgefühl gegenüber den Kindern. Viel hat sie sich vorzuwerfen, und sie erleidet Scham-Attacken bei der Erinnerung an schlimme Szenen des Versagens: Mutter im vollgekotzten Bett, nicht wachzukriegen. Von dem wenigen, das sie verdient, bildet Paula Rücklagen - um Wiedergutmachungsgeschenke zu kaufen.
In der Darstellung von Paula und ihren Kindern triumphiert Doyles sparsame Darstellungsweise. Nicola hat den Absprung geschafft und ist in bessere Verhältnisse gekommen - eine Tochter, die ihre Überlegenheit auch angesichts der in die Zurechnungsfähigkeit zurückkehrenden Mutter bewahren möchte. Jack, mit gerade achtzehn der Jüngste, müsste eigentlich schwer traumatisiert sein. Paula erinnert sich, wie er vor den Kneipen auf sie wartete. Aber Jack ist ein merkwürdig unbeschädigter Junge, auf ungreifbare Weise nett. "Er ist zu sehr wie ein verdammter Heiliger, denkt sie manchmal. Dann möchte sie ihn nehmen und schütteln. Möchte, dass er mit Gegenständen schmeißt und sie hasst. Das würde sie verstehen, damit könnte sie umgehen."
Erwartbarer verhält sich Tochter Leanne, die selbst zu viel trinkt und auf die Paula deshalb ihre Alkoholängste projiziert. Die geheilte Trinkerin muss ihr Sendungsbewusstsein zügeln. Und dann ist da immer die Vorstellung, dass Leanne irgendwo noch eine Flasche versteckt hält. Manchmal, wenn die Stimmung kippt oder altes Unglück nagt, meldet sich bei Paula die Gier: "Sie braucht einen Schluck, jetzt sofort." Mantraartig muss sie sich zur Ruhe rufen: "Paula wird sich stellen, sie wird nicht weglaufen." Oder: "Ihr geht's gut. Ihr geht's gut." Vor allem mittels hochdosierter erlebter Rede gelingt es Roddy Doyle, in Paulas Seele zu kriechen und sie in dichter Beschreibung und mit rauher Zärtlichkeit so zu vergegenwärtigen, dass man meint, es nicht mit einer literarisch konstruierten Figur, sondern einem lebendigen Menschen zu tun zu haben. Bisweilen wird der irische Alltag allerdings ins Relief getrieben: "Wie sind die Bratkartoffeln?" - "Spitze." - "Ich hatte noch Kartoffeln übrig." - "Große Klasse." Und dann gibt es leider auch Kapitel, die sehr nach Daily Soap klingen. Das gilt insbesondere für Paulas ausführlich geschilderte Treffen mit ihren beiden Schwestern. Hier fängt die wiedererrungene Normalität an, penetrant zu werden. Vielleicht hat das auch Doyle gespürt, und so lässt er die ältere der Schwestern gegen Ende noch schnell an einem literarisch indizierten Brustkrebs erkranken.
Was an dem Buch stören kann, ist seine Sprache, dieses auf kleinste Einheiten heruntergebrochene Satzwerk: "Die neue Paula glaubt fast alles. Sie ist ein bisschen überdreht. Nicht jetzt. Aber manchmal. Vor Glück. Weil sie am Leben ist." Schon klar, auch die neue Paula denkt nicht in Thomas-Mannschen Satzgeflechten. Aber warum eigentlich nicht? Weil zur ausgepowerten Putzfrau nur minimalistische Grammatik und kurzatmige Stakkato-Sätze passen? Gewiss, der Assoziationsstil lässt sich rechtfertigen. Es geht ja nicht um Reflexion oder aufwendige Beschreibung, sondern um die akuten Reaktionen Paulas auf ihre Umwelt - wie sie sich vorantappt im neuen Alltag, was ihr so durch den Kopf geht. Deshalb erscheint auch das Erzählen im Präsens, das oft gekünstelt wirkt, als plausible Form, mit der sich der unmittelbare Gegenwartsdruck darstellen lässt. Trotzdem: Gegenüber der naturalistischen Abbildung des existentiellen Stolperns durch Stolpersyntax hätte die Vermittlung eines komplizierten Lebens durch komplexere Sätze vielleicht ästhetische Vorzüge gehabt.
Am Ende landet Paula nicht im Glück. Das erprobte Misstrauen der Kinder verschwindet nicht in einem Jahr, die Bewährungszeit ist länger, vielleicht lebenslänglich. Und Paula steht nach wie vor am Abgrund. Lange wird ihr Körper die Putzerei nicht mehr mitmachen. Über eine Altersvorsorge verfügt sie nicht. Immerhin, am Ende taucht ein gewisser Joe auf, ein älterer Herr, am Glascontainer lernt sie ihn kennen, und eine spröde Romanze kommt auf den Weg. Wohin sie führen wird - Roddy Doyle wird es verraten, wenn es so weit ist. Denn wenn nicht alles täuscht, wird er das Paula-Leben in einiger Zeit fortschreiben. Man kennt das Muster von John Updike, der mehrfach die Jahrzehnte resümierte mit seiner Rabbit-Figur Harry Angstrom, dem amerikanischen Jedermann. Paula Spencer ist die irische Jedefrau. Bis bald, Paula.
WOLFGANG SCHNEIDER
Roddy Doyle: "Paula Spencer". Roman. Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann. Carl Hanser Verlag, München 2008. 302 S., geb., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
[A] marvellous novel Carmen Callil Financial Times