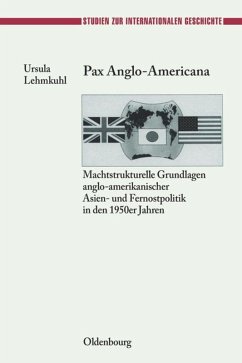Das erste Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg stellt eine Phase dar, in der die Sonderbeziehungen zwischen Großbritannien und den USA in vielerlei Hinsicht vor neuen Herausforderungen und Belastungsproben standen. Die Studie untersucht die facettenreiche "special relationship" in der Hochphase des Kalten Krieges und fragt danach, inwieweit die USA in der Asien- und Fernostpolitik in der Lage waren, die Ziele und Positionen der eigenen Gobalplanung gegenüber den konkurrierenden britischen Interessen durchzusetzen. Es zeigt sich, daß der Machtverlust, den Großbritannien in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht durch den Zweiten Weltkrieg erlitten hatte, nicht mit einem Einflußverlust in der internationalen Politik gleichgesetzt werden darf.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Warum die Briten nach dem Krieg noch eine Rolle spielten
Ursula Lehmkuhl: Pax Anglo-Americana. Machtstrukturelle Grundlagen anglo-amerikanischer Asien- und Fernost-Politik in den 1950er Jahren. Studien zur Internationalen Geschichte, Band 7. R. Oldenbourg Verlag, München 1999. 303 Seiten, 148,- Mark.
Großbritannien ging aus dem Zweiten Weltkrieg als eine der Siegermächte hervor, aber es war nicht zu übersehen, dass die politische, militärische und wirtschaftliche Kraft dieses Landes erheblich abgenommen hatte; Großbritannien zählte nur noch bedingt zu den Weltmächten. Doch verfügte es noch über einige Trümpfe, die in der internationalen Politik ausgespielt werden konnten: Es war das Zentrum des Commonwealth und des Sterling-Blocks, und es besaß langjährige Erfahrungen in den Beziehungen zu und im Umgang mit Ländern Asiens und Afrikas. Gerade dieser letztere Umstand machte Großbritannien wertvoll für die Vereinigten Staaten. Die waren dabei, sich in ihre neue Rolle als Führungsmacht des Westens einzugewöhnen, wobei sie feststellen mussten, dass es ihnen an kulturellen und sprachlichen Erfahrungen im Hinblick auf asiatische Länder mangelte. Die These Ursula Lehmkuhls ist, dass Großbritannien auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen und seines diplomatischen Geschicks im Verhältnis zu seinem Partner Vereinigte Staaten und darüber hinaus in seinen internationalen Beziehungen einen Einfluss ausüben konnte, der weit über seine materiellen - militärischen und wirtschaftlichen - Machtmittel hinausging.
Im Vorwort kündigt die Verfasserin eine Gratwanderung zwischen politikwissenschaftlicher und historischer Herangehensweise an. Doch verlässt sie bald den mittleren Pfad und bewegt sich in eine vorwiegend politikwissenschaftliche Richtung. So erörtert sie die politikwissenschaftlichen Konzepte von Macht, Einfluss, Hegemonie. Anstelle der traditionellen, machtbetonten Definitionen von Macht und Hegemonie verweist sie auf die Bedeutung "kommunikativen Handelns" und "verständigungsorientierter Koordination" in den Beziehungen zwischen Staaten. Sie untersucht diese Konzepte am Beispiel der "special relationship" zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die auf Grund eines weiten gemeinsamen kulturellen Erbes, gemeinsamer Werte und sprachlicher Gemeinsamkeit entstehen konnte. Diese Übereinstimmungen ermöglichten es auch, gelegentlich auftretende Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel über den wirtschaftlichen Wiederaufbau Japans, durch verständigungsorientiertes Handeln zu überwinden. Fraglich ist jedoch, ob dieses Konzept, das so gut auf die anglo-amerikanische "special relationship" zutrifft, auf andere Bereiche angewendet werden kann, zum Beispiel dort, wo grundsätzlich antagonistische Beziehungen vorherrschen.
Die Autorin beschreibt die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen britischer und amerikanischer politischer Kultur und ihre Auswirkungen auf die Kooperation in zwei Politikbereichen: der auswärtigen Informationsund Kulturpolitik sowie der Außen-, Wirtschafts- und Währungspolitik. In beiden erwies sich die Kooperation als erfolgreich; die Unsicherheit der Vereinigten Staaten im Umgang mit bisher wenig beachteten Ländern konnte kompensiert werden durch den britischen Beitrag an Erfahrungen. Es entstand - zumindest für den behandelten Zeitraum der fünfziger Jahre - eine wechselseitige Abhängigkeit, die es London ermöglichte, weiterhin erheblichen Einfluss auf die internationale Politik auszuüben. Begünstigt wurde die Position Großbritanniens durch den Kontext des Kalten Krieges, in dem es als treuester Partner der Vereinigten Staaten galt. Allerdings waren auch Grenzen der "special relationship" zu beachten: Sie durfte nicht dazu führen, dass sich andere Bündnispartner - Frankreich, die Bundesrepublik - ausgeschlossen fühlten. Dem im Untertitel angekündigten Bezug auf die Asien- und Fernost-Politik wird die Untersuchung nur zum Teil gerecht. Der größere Teil befasst sich mit politiktheoretischen Erörterungen und der Analyse der "special relationship", die nur in allgemeiner Weise Asien betreffen. Die Erörterung eigentlicher Asien-Politik beschränkt sich auf vier Probleme: das Export-Embargo gegen China, die Diskussion um die umstrittene Mitgliedschaft Japans im Sterling-Block, im Gatt und im Colombo-Plan.
HANS KLUTH
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hans Kluth äußert sich zurückhaltend über dieses Buch, dessen Thematik er in seiner Rezension auch Außenstehenden zu vermitteln versucht. Dies scheint ihm vor allem deshalb wichtig zu sein, weil der Untertitel ihm etwas irreführend erscheint: Die Asien- und Fernostpolitik spiele nur eine etwas untergeordnete Rolle. Lehmkuhls Äußerungen diesbezüglich seien eher indirekt relevant, da sich die Autorin viel mehr mit der ?special relationship? zwischen England und den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Die von der Autorin im Vorwort angekündigte ?Gratwanderung zwischen politikwissenschaftlicher und historischer Herangehensweise? finde außerdem nicht wirklich statt, da nach Ansicht des Rezensenten das Schwergewicht in der Darstellung sehr stark in der politikwissenschaftlichen Betrachtung liegt. Die Analyse der Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen England (das zwar politisch und wirtschaftlich geschwächt war, aber über weitreichende Beziehungen zu afrikanischen und asiatischen Ländern verfügte) und den Vereinigten Staaten scheint der Rezensent jedoch recht fundiert und in den meisten Punkten überzeugend zu finden.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH