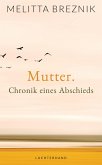Vom Waisenkind zum Millionär - wie konnte das so schiefgehen?
Peter Holtz will das Glück für alle. Schon als Kind praktiziert er die Abschaffung des Geldes, erfindet den Punk aus dem Geist des Arbeiterliedes und bekehrt sich zum Christentum. Als CDU-Mitglied (Ost) kämpft er für eine christlich-kommunistische Demokratie. Doch er wundert sich: Der Lauf der Welt widerspricht aller Logik. Seine Selbstlosigkeit belohnt die Marktwirtschaft mit Reichtum. Hat er sich für das Falsche eingesetzt? Oder für das Richtige, aber auf dem falschen Weg? Und vor allem: Wie wird er das Geld mit Anstand wieder los? Peter Holtz nimmt die Verheißungen des Kapitalismus beim Wort.
Mit Witz und Poesie lässt Ingo Schulze eine Figur erstehen, wie es sie noch nicht gab, wie wir sie aber heute brauchen: in Zeiten, in denen die Welt sich auf den Kopf stellt.
Peter Holtz will das Glück für alle. Schon als Kind praktiziert er die Abschaffung des Geldes, erfindet den Punk aus dem Geist des Arbeiterliedes und bekehrt sich zum Christentum. Als CDU-Mitglied (Ost) kämpft er für eine christlich-kommunistische Demokratie. Doch er wundert sich: Der Lauf der Welt widerspricht aller Logik. Seine Selbstlosigkeit belohnt die Marktwirtschaft mit Reichtum. Hat er sich für das Falsche eingesetzt? Oder für das Richtige, aber auf dem falschen Weg? Und vor allem: Wie wird er das Geld mit Anstand wieder los? Peter Holtz nimmt die Verheißungen des Kapitalismus beim Wort.
Mit Witz und Poesie lässt Ingo Schulze eine Figur erstehen, wie es sie noch nicht gab, wie wir sie aber heute brauchen: in Zeiten, in denen die Welt sich auf den Kopf stellt.

Geht das, vom Geld zu erzählen, ohne dabei moralisch zu werden? Geht es, einen Schelmenroman zu schreiben, ohne dabei humorig zu klingen? Ingo Schulzes großer ironischer Roman "Peter Holtz"
Ist es möglich, einen Roman über Geld zu schreiben? Nicht bloß als moralische Erzählung, sondern als Darstellung der Eigendynamik dieser merkwürdigen Figur, die so sehr mit allem, was wir für rational und selbstverständlich halten, verwoben ist, dass wir sie kaum wahrnehmen können? Und mit der man zugleich mitten in den ideologischsten Scharmützeln steckt, wo das pure Meinen allen literarischen Atem zu ersticken droht? Das ist keine müßig-akademische Frage. Die Darstellbarkeit großer Teile der Gegenwart hängt daran, vom Wohnungsproblem bis zu der Rolle, die zum Beispiel die Kunst für das Leben heute spielt.
Das Großartige an Ingo Schulzes neuem Roman ist, dass er den Hochstand und zugleich die Froschperspektive einer so umfassenden Ironie einzunehmen versteht, dass sie das vermeintlich so abstrakte, aber wirkmächtige Treiben des Geldes völlig unangestrengt und dabei ohne Einbuße an Komplexität zu fassen bekommt. Dieser Hochstand, der die bundesrepublikanische Jetztzeit sichtbar macht, ist für Schulze ausgerechnet die DDR, allerdings eine DDR, wie es sie nie gegeben hat und wie sie sich nur im Bewusstsein seines Helden Peter Holtz findet. Peter ist ein Waisenkind, das nichts als das Gute will, und zwar für alle. Im Kinderheim "Käthe Kollwitz" lernt es, die idealistischen Überbauten, mit denen sich die Systeme zu legitimieren pflegen, beim Nennwert zu nehmen, während doch alle Welt um ihn herum zu wissen glaubt, dass sich das wirkliche Leben ganz unabhängig von solchen Redeweisen abspielt.
Der Roman setzt ein in einem Ausflugslokal der DDR des Jahres 1974. Der bald zwölfjährige Peter erklärt der Kellnerin, dass er über kein Geld verfüge und dass dies auch nicht nötig sei. "Unsere Gesellschaft" müsse ja ohnehin für ihn sorgen, solange er Kind ist, und da sei es doch "naheliegend", ihm das verzehrte Eisbein nicht zu berechnen. ",Warum soll mir unsere Gesellschaft das Geld erst aushändigen', frage ich, ,wenn dieses Geld doch über kurz oder lang sowieso bei ihr landet?'" Worauf die Kellnerin sagt: "Bei dir piept's ja."
Damit ist der Ton angeschlagen, den Schulze mit bewundernswerter Leichtigkeit und Präzision bis zur letzten Seite durchhält. Der Ich-Erzähler Peter Holtz ist ein reiner Tor, der allmählich selber merkt, dass er in einer eigenen Welt lebt, die auf alle anderen befremdlich wirkt. "Wir leben zwar alle im Sozialismus", sagt er einmal, "aber keiner scheint das zu begreifen, keiner kapiert, was für ein Glück das eigentlich ist."
Und so vereint er alle nur denkbaren Unmöglichkeiten in sich: Er ist so stolz darauf, mit der Stasi zusammenarbeiten zu dürfen, dass er das sofort überall weitererzählt; er erfindet aus Versehen den Punk, da er geliebte Hymnen wie "Sag mir, wo du stehst" im Stimmbruch herausbrüllt; er tritt in die Blockflötenpartei CDU ein, um aus ihren Mitgliedern "Christlich Kommunistische Demokraten" zu machen. Und er ist sogar so selbstlos, dass er sich von einer alten Dame ein paar alte Häuser schenken lässt, obwohl er mit den mageren Mieten bei weitem nicht die nötigen Reparaturen bezahlen kann.
Die Immobilien sind dann das Scharnier, das die aufeinanderfolgenden Systeme in ein Verhältnis zueinander bringt. Die Häuser, die in der DDR bloß Arbeit und Draufzahlen bedeuteten, machen den gutmütigen Peter in der Bundesrepublik plötzlich zum Multimillionär. Womit sich die Frage des Geldes, das er ja schon als Kind für eine unnötige Vorschaltung vor die Gesellschaft hielt, in verschärfter Form stellt. Auch in der Marktwirtschaft nimmt er die idealistischen Überhöhungen beim Wort. Von einem Immobilienmogul lässt er sich zum Privateigentum bekehren, hält aber an seinem Ziel des wahren Kommunismus fest, den er nun nicht länger über den Sozialismus, sondern über den Kapitalismus erreichen will. Wobei ihm klar ist, dass der Markt "einen auch ganz schön in die Irre führen" kann, etwa wenn er einen nur noch an die Geldvermehrung denken lasse: "Das kann ja nicht der Sinn der Marktwirtschaft sein."
All solche Grundsätzlichkeiten gehen geradezu schwerelos in eine Handlung ein, die voller genauer Alltagsbeobachtungen und Pointen steckt. Der Wandel der Zeiten zeigt sich in der wechselvollen Geschichte von Peters Pflegefamilie (zu der dann später überraschend noch die totgeglaubte leibliche Mutter aus dem Westen anrückt) und seinen vielen Freunden und Freundinnen. Als CDU-Mitglied und Galerist kommt Peter auch noch mit allen möglichen Gestalten der Zeitgeschichte in Berührung, die mit Klarnamen vorgestellt werden (Gerhard Schröder) oder ohne (zum Beispiel Merkel als umsichtige Pressesprecherin). Die Simplicissimushaftigkeit, die vom Charakter des Helden auf die formale Gestaltung des Romans überspringt, sorgt für einen hintergründigen V-Effekt. Jedes Kapitel wird von einem barocken Vorspruch eingeleitet, das fünfzehnte Kapitel vom Buch V zum Beispiel, "in dem es Peter schwerfällt, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Es passiert zu viel für jeden einzelnen Tag. Und das Entscheidende steht noch bevor." Erzählt wird in dem Kapitel dann, wie am Abend des 9. November 1989 bei einer Versammlung von Oppositionsparteien die Nachricht von der Maueröffnung beinahe untergeht; die Zwischenruferin wird ermahnt, sich an die Tagesordnung zu halten.
Schon in früheren Romanen wie "Simple Storys" oder "Neue Leben" hatte Ingo Schulze den Epochenwechsel in vielen komischen und traurigen Details beschrieben. Doch "Peter Holtz" unterscheidet sich von diesen Vorgängern stark: Die DDR fungiert hier bloß als Folie, um die Gegenwart zu sezieren. Die Harmlosigkeit, die die Gattungsbezeichnung "Schelmenroman" suggeriert, trügt; sogar als Satire würde man das Tückische dieses Buchs unterschätzen.
Peter experimentiert auf vielfältigste Weise mit dem für ihn ungewohnten Markt. Er macht ein Bordell auf, steckt sein Geld in die irrealsten Projekte, steigt über seine kunsterfahrene Ziehschwester ins Galeriegeschäft ein. Das Verrückte ist, dass ihm in seiner Naivität alles glückt und er immer reicher und dicker wird. Die eigentliche Aufgabe aber bleibt für ihn unerfüllt: "Das Geld sollte uns voranbringen, es sollte etwas bewirken, auch in uns!" Aber was er auch versucht: "Irgendwie verkehrt sich alles in sein Gegenteil!" Er will seine Häuser den Bewohnern schön machen, aber die ziehen wegen der gestiegenen Mieten aus. Er stößt die für zehn Millionen gekauften Aktien einer Firma ab, nachdem er erfährt, dass sie gerade fünfhundert Arbeiter entlassen hat, und schon sind sie zwölf Millionen wert. Die schlimmsten Erfahrungen macht er mit dem Geld, das er anfangs großzügig unter Freunden und Bekannten verteilt und sie damit ins Chaos stürzt.
In einer Fortsetzung des Sterntaler-Märchens, das ihm einmal als Phantasie durch den Kopf rauscht, gibt das kleine Waisenmädchen auch seine Taler, die ihm der Himmel geschenkt hat, an andere ab. Doch weil jetzt so viele Taler im Umlauf sind, dass deren Wert von Tag zu Tag fällt, kann sie mit all ihrem Reichtum nur die Miete für eine Woche bezahlen. Und obendrein gilt sie auch noch als "die Schuldige, die all das Geld unter die Menschen gebracht hat, so dass rein gar nichts mehr so sein will wie bisher und die Menschen hungern und ihre Häuser verlassen müssen und einander totschlagen . . ."
Schulzes große Kunst besteht darin, dass er sich in dem ganzen Roman nicht den geringsten humorigen Tonfall erlaubt. Die ökonomischen und politischen Wirklichkeiten sowohl der DDR wie der Bundesrepublik kommen zur Geltung, in den Dialogen erhalten die Ansichten Peters immer auch eine realistische Antwort, es wird nichts zurechtgebogen, damit irgendeine These oder Pointe aufgeht. Alles wird tatsächlich "aufgehoben" in diesem Roman, und gerade deswegen sieht man nach seiner Lektüre auch alles etwas anders, nämlich mit einem abgründigen Aberwitz infiziert. Das ist das Verdienst von Peter Holtz und seiner quer zu allen üblichen Ideen und Logiken stehenden Menschenfreundlichkeit. Er wird als eine verblüffend souveräne Gestalt der Gegenwartsliteratur in Erinnerung bleiben. Am Ende findet er mit Hilfe der Kunst doch noch sein Glück und einen Ausweg, aber der soll hier nicht verraten werden.
MARK SIEMONS
Ingo Schulze: "Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst". S. Fischer, 571 Seiten, 22 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Ingo Schulzes neuer Roman "Peter Holtz" ist ein "Schelmenstück für unsere Zeit", so Cornelia Geissler. Peter wächst in der DDR in einem Kinderheim auf, nimmt irgendwann aber Reißaus und wird, naiv indoktriniert wie er ist, mit der Welt konfrontiert, der er so unbedarft neugierig begegnet als käme er von einem anderen Stern, resümiert die Rezensentin. Nach der Wende wird aus Peter quasi wider Willen, oder zumindest aus Versehen, ein ziemlich erfolgreicher Kapitalist, der sich die Schultern mit Politikern reibt - die sich unschwer identifizieren lassen, selbst wenn nicht alle unter Klarnamen auftreten, verrät Geissler. Schulz mag einen Schelmenroman geschrieben haben, aber die politischen Seitenhiebe in verschiedenste Richtungen muss man nicht lange suchen, freut sich die Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
bewundernswerte Leichtigkeit und Präzision bis zur letzten Seite [...] große Kunst [...] Mark Siemons Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20170903
Ingo Schulzes neuer Roman "Peter Holtz" ist ein "Schelmenstück für unsere Zeit", so Cornelia Geissler. Peter wächst in der DDR in einem Kinderheim auf, nimmt irgendwann aber Reißaus und wird, naiv indoktriniert wie er ist, mit der Welt konfrontiert, der er so unbedarft neugierig begegnet als käme er von einem anderen Stern, resümiert die Rezensentin. Nach der Wende wird aus Peter quasi wider Willen, oder zumindest aus Versehen, ein ziemlich erfolgreicher Kapitalist, der sich die Schultern mit Politikern reibt - die sich unschwer identifizieren lassen, selbst wenn nicht alle unter Klarnamen auftreten, verrät Geissler. Schulz mag einen Schelmenroman geschrieben haben, aber die politischen Seitenhiebe in verschiedenste Richtungen muss man nicht lange suchen, freut sich die Rezensentin.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Filou-Grundstücke
Ein Schelm, wer an das Gute glaubt: In seinem Roman „Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“
schickt Ingo Schulze einen Homunkulus des Sozialismus in den Kapitalismus
VON GUSTAV SEIBT
Am Ende sehen wir Peter Holtz, den Helden und Ich-Erzähler von Ingo Schulzes neuem Roman, als „ökonomischen Häftling“ in Gewahrsam. Er hat Tausend-Mark-Scheine am Berliner Alexanderplatz angezündet, einen nach dem anderen. Das konnte die Zuschauer nicht lange ertragen. Mit der Einweisung in ein Heim schließt sich ein Kreis. Denn am Beginn der Erzählung war der zwölf Jahre alte Peter aus einem Kinderheim ausgerissen. Auf seiner Wanderung hatte er in einem Ausflugslokal gegessen und verweigerte nun die Bezahlung: „Warum soll mir die Gesellschaft das Geld erst aushändigen, wenn dieses Geld über kurz oder lang sowieso wieder bei ihr landet?“
Geld sei im Sozialismus unsinnig, so hat es Peter Holtz von seinen Lehrern gelernt: „Wenn du ohne Geld durch unsere Republik reisen und dich sattessen kannst, dann hat der Kommunismus gesiegt.“ Wir sind in der DDR, im Jahr 1974. Das Ende spielt 1998, am Beginn von Gerhard Schröders Kanzlerschaft. Die mehr als 500 Seiten dazwischen entrollen ein deutsch-deutsches Zeitpanorama, aus der Sicht eines Menschen, der sichtlich ein Problem mit dem Geld hat. Ingo Schulze nennt es im Nachwort einen „Schelmenroman“.
Peter Holtz hat keine Familie, das passt zu dieser Gattung. Er ist, ganz wörtlich, das Kind seines Staates. Ins Heims kam er, so wird ihm erzählt, weil seine Eltern einen tödlichen Unfall hatten. Erst nach der Wende erfährt er, dass sie in den Westen gingen und ihn nicht mitnehmen durften, ohne dass Peter das über die Maßen erschütterte. Auch dass der Leiter des Kinderheims, dessen antifaschistische Heldenhaftigkeit Peter als Kind verehrte, in Wahrheit sein leiblicher Großvater war, kommt erst nach dem Mauerfall ans Licht. Der klassische Schelmenroman hatte es immer mit unvermuteten Abstammungen und überraschenden Wiederbegegnungen zu tun.
Zum Zeitpunkt seiner Flucht aus dem Heim – sie galt der Suche nach dem wunderbaren Heimvater, der versetzt worden sei, in Wahrheit aber verstarb (wieder so eine nachträgliche Schicksalsinformation) – ist Peters kindliche sozialistische Persönlichkeit bereits so gefestigt, dass er von einer ziemlich bürgerlichen Familie des sozialistischen Adels, nämlich Nachfahren eines Widerstandskämpfers gegen die Nazis, adoptiert werden kann. Seine Heimat ist fortan eine bröckelnde Villa in Berlin-Treptow. Man kann an Uwe Tellkamps "Turm" denken. Peter, der schon als Heimkind gegen das Zertrampeln von Grünflächen gekämpft hatte - "warum zerstören wir mutwillig, was uns allen gehört?" - bleibt bei seiner unbedingten sozialistischen Gläubigkeit.
Wenn ein Mitschüler schlecht über den Staat redet, plappert Peter es entrüstet herum, worauf dieser von der Schule fliegt. Einer subversiven Punk-Band dient er als als Sänger, der Parteilieder wie „Sag mir, wo du stehst“ zu harten Elektroklängen so inbrünstig kräht, dass nur er die Ironie nicht versteht. Westbesuche will er mit dem Neuen Deutschland bekehren. Auch mit der Stasi spricht er - warum nicht mit Experten reden? -, allerdings erzählt er auch das herum, sodass die Konspiration misslingt.
Was ist das für ein Schelm? Einmal wird er „ein Kaspar Hauser“ genannt. Dass die Leute den kleinen Streber zu fürchten beginnen, entgeht ihm. Peter Holtz nimmt seine sozialistische Umgebung zum ideologischen Nennwert, als gäbe es keine Kluft zwischen den Worten und der Wirklichkeit. Macht, Gewalt, Zynismus – dafür ist er taub oder farbenblind. Ingo Schulze konstruiert einen Homunkulus des Sozialismus, von dem nicht immer klar ist, ob man ihn komisch oder grauenhaft finden soll.
Daher geht ihm die Filouhaftigkeit klassischer Schelmen von Lazarillo bis zum Soldaten Schweijk ab. Seine Affirmation ist total, sie hat auch nichts von Sklavensprache. Subversiv ist Peter Holtz durch die vollkommene Abwesenheit von Subversivität. Der Name scheint sprechend, er ist ein Holzkopf. Wie bringt man eine solche gläubig kommunistische Figur in den Kapitalismus? Das ist, nach einem etwas behäbig vor sich hintuckerndem Beginn, die interessante Aufgabe, die Ingo Schulze sich vorgenommen hat. Er löst sie mit sanftem Witz. Mit dem Jahr 1989 nimmt der Schelmenroman Fahrt auf.
Zwei Voraussetzungen muss Schulze seinem Peter dafür noch andichten. Schon vor der Wende wird Peter Holtz Christ. In aller Unschuld findet er nämlich, der Kommunismus sei nur die andere Seite des Christentums: „Mit dem Glauben verfüge ich über ein zweites Standbein.“ So kann er in die Ost-CDU eintreten, und mit sich im Reinen bleiben. Die zweite Voraussetzung für Peters Nachwende-Karriere ist sein Immobilienvermögen. Häuser sind eine Last in der DDR, renovierungsbedürftig, kostspielig, ertragsarm. Also wird dem linientreuen Maurer (das lernt der schlichte Schelm) von seiner ostbürgerlichen Umgebung ein Haus nach dem anderen überschrieben. Irgendwann hat er „zwölf Mietshäuser, eine Villa und zwei Buden in Mitte“, und dafür muss er schuften: Er fährt schwarz Taxi, um Geld für Handwerker aufzutreiben.
Beides, die Ost-CDU-Vergangenheit und das Immobilienvermögen, erlaubt Peter Holtz, der den Mauerfall im Koma verschläft wie die Mutter in dem Film „Good bye, Lenin“, eine politisch-ökonomische Blitzkarriere in der Nachwende-DDR. Er kommt in Berührung mit Roman-Stellvertretern von Lothar de Maizière und Angela Merkel. Die Schrottimmobilien sind auf einmal großes Kapital. Peter Holtz ist kurz Wende-Held, und auf Dauer Millionär.
Hier wird der Roman lustig, er bekommt etwas vom Brio der Anfänge Ingo Schulzes, die ja immer wieder vom Augenblick des Glücks der ungeheuren Offenheit 1989/90 handelten. Peter Holtz lernt den Kapitalismus nicht nur kennen, irgendwann verinnerlicht er ihn. Er will gut sein zu seinen Mietern, aber auch zu einer Prostituierten, bei der er zu seiner grenzenlosen Überraschung erfahren hat, dass Sex für Geld funktioniert. Also richtet er ihr ein kleines kuschliges Bordell in der Auguststraße, dem späteren Galerie- und Kunstkiez in Mitte ein.
„Holtz-Immobilien“ ist kurz davor, zum Imperium zu werden: Shopping-Malls an Fabkrikstandorten, Wellness in einer Traglufthalle, Schnäppchen bei der Treuhand. Peter schlafwandelt weiter treuherzig durch die Welt, diesmal lässt er sich, bezeichnenderweise von einem Kunsthändler, in Marktwirtschaft belehren. Wer Eigentum verschenken wolle, erklärt ihm dieser, der überlasse die Geschicke dem Zufall, schaffe bestenfalls Lottogewinne für die Empfänger.
Volkseigentum werde verschlissen (der zertrampelte Rasen vorm Kinderheim!), nur Eigentum erlaube Verantwortung, und überhaupt: „Es ist noch kein besseres Mittel als Geld erfunden worden, um Gerechtigkeit herzustellen.“ Die Religion von Eigentum und Verantwortung übernimmt Peters hölzerner Kopf erst einmal. Sogar shoppen und ein wenig genießen lernt er, das tiefe Befremden über die Warenwelt mit ihren nachwachsenden Regalen im Supermarkt und dem Service-Sprech des Personals, hält eine Erfahrung von 1990 frisch. Aber freilich: Es bleibt Peter unangenehm, von Dienern bedient zu werden, auch wenn man ihm hundertmal erklärt, das sei Arbeitsteilung. Das sozialistische Ich ist nicht tot, es wird ja noch gebraucht.
Fassungslos erkennt Peter Holtz, der eine subversive Halbschwester hat, die eine Galerie führt, dass Kunst Geld schaffen kann. Peter wird zu einer Performance verleitet, bei der er in einer Galerie mehr als 800 000 DM in Scheinen verbrennt. Wird hier Geld vernichtet? Keineswegs! Der Film, der das Event dokumentiert, bringt schon in erster Lizenz mehr als eine Million DM ein. Peter Holtz, der etwas von einem Midas hat, dem alles zu Gold wird, und der zugleich weniger Schelm als Candide in der besten aller ökonomischen Welten ist, kann das Geld nicht loswerden.
Nicht, dass die Gesellschaft insgesamt besser würde. Anzeichen von Unordnung mehren sich: Das kleine Privat-Bordell zieht gewaltbereite Konkurrenz aus Osteuropa an. Abgewickelte Fabrikbelegschaften protestieren und suchen nach selbstbestimmten Managementalternativen. Nazis tauchen auf. Versuche, die Steuerverwaltung zu bereden, mehr zu zahlen, scheitern bürokratisch. Der Reichtum Peters zieht einen Erpresser an. Die Adoptivmutter wird Direktorin bei der Deutschen Bank und sackt das Filialnetz der Staatsbank der DDR ein. Anders als im Sozialismus übersieht Peter diesmal die Kollateralschäden nicht. Der Schelm wird auf dem rechten Auge sehend.
Eine Begegnung mit Gerhard Schröder - der „ist jemand, der zuhört, der nachfragt, den interessiert, was andere Menschen denken“, wird ihm versichert – gibt Peter den Rest. Übrigens tritt Schröder als einzige historische Figur mit Klarnamen auf, der Roman verlässt also an seinem Ende kurz den Bezirk der Fiktion. Nun sucht Peter verzweifelt die „Selbstreinigung des Kapitalismus“: „Wenn das Geld zum Henker der Dinge wird, hat es keine Berechtigung mehr.“ Am 1. September 1998, kurz vor Schröder Amtsantritt, ist es so weit: An der Weltzeituhr beginnt die diesmal nicht künstlerische, sondern unsymbolische Geldverbrennung, die zu Aufruhr und Einweisung ins Heim führt. Das Geld beweist seine dämonische Macht noch in der Vernichtung, welche die Menschen verrückt macht: „Se können doch nicht unser Jeld verbrenn!“ Allerdings: Geld kann man gar nicht verbrennen. Es steht ja in den Büchern.
Wie alle Kunstwerke vom Geld handelt Ingo Schulzes Roman von einem Fluch. Gibt es ein Jenseits? Ja, an einer Stelle. Peter Holtz reist einmal nach Südfrankreich. Die Schönheit der Sprache dort, das Licht, der Himmel, die Natur überwältigen ihn. „Ich sehe die Dinge und Wesen dieser Welt an, als würde ich zum ersten Mal ihrer Körperlichkeit gewahr. Plötzlich erschreckt mich die Idee: Es muss sich gar nichts ändern! Alles soll bleiben, wie es ist!“
Das wäre die Welt, in der es keine Kluft zwischen den Worten und den Verhältnissen gibt. Ist es wieder einmal das südliche Licht, das vom Hadern mit den Abstraktionen erlöst?
Peter Holtz hat etwas
von einem Midas,
dem alles zu Gold wird
Ingo Schulze
Foto: Regina Schmeken
Links:
Berlin Mitte,
Juli 1992.
Hier wird Peter Holtz
zum Millionär, indem er einstürzende
Altbauten renoviert.
Foto: Gade-Ullstein
Rechts:
Brüssel, Zentrum,
Mai 2017.
In Robert Menasses
Roman wird in der
Hauptstadt Europas
ein Mord vertuscht.
Foto: imago/ZUMA Press
Ingo Schulze:
Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017. 570 Seiten, 22 Euro. E-Book 19,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Ein Schelm, wer an das Gute glaubt: In seinem Roman „Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“
schickt Ingo Schulze einen Homunkulus des Sozialismus in den Kapitalismus
VON GUSTAV SEIBT
Am Ende sehen wir Peter Holtz, den Helden und Ich-Erzähler von Ingo Schulzes neuem Roman, als „ökonomischen Häftling“ in Gewahrsam. Er hat Tausend-Mark-Scheine am Berliner Alexanderplatz angezündet, einen nach dem anderen. Das konnte die Zuschauer nicht lange ertragen. Mit der Einweisung in ein Heim schließt sich ein Kreis. Denn am Beginn der Erzählung war der zwölf Jahre alte Peter aus einem Kinderheim ausgerissen. Auf seiner Wanderung hatte er in einem Ausflugslokal gegessen und verweigerte nun die Bezahlung: „Warum soll mir die Gesellschaft das Geld erst aushändigen, wenn dieses Geld über kurz oder lang sowieso wieder bei ihr landet?“
Geld sei im Sozialismus unsinnig, so hat es Peter Holtz von seinen Lehrern gelernt: „Wenn du ohne Geld durch unsere Republik reisen und dich sattessen kannst, dann hat der Kommunismus gesiegt.“ Wir sind in der DDR, im Jahr 1974. Das Ende spielt 1998, am Beginn von Gerhard Schröders Kanzlerschaft. Die mehr als 500 Seiten dazwischen entrollen ein deutsch-deutsches Zeitpanorama, aus der Sicht eines Menschen, der sichtlich ein Problem mit dem Geld hat. Ingo Schulze nennt es im Nachwort einen „Schelmenroman“.
Peter Holtz hat keine Familie, das passt zu dieser Gattung. Er ist, ganz wörtlich, das Kind seines Staates. Ins Heims kam er, so wird ihm erzählt, weil seine Eltern einen tödlichen Unfall hatten. Erst nach der Wende erfährt er, dass sie in den Westen gingen und ihn nicht mitnehmen durften, ohne dass Peter das über die Maßen erschütterte. Auch dass der Leiter des Kinderheims, dessen antifaschistische Heldenhaftigkeit Peter als Kind verehrte, in Wahrheit sein leiblicher Großvater war, kommt erst nach dem Mauerfall ans Licht. Der klassische Schelmenroman hatte es immer mit unvermuteten Abstammungen und überraschenden Wiederbegegnungen zu tun.
Zum Zeitpunkt seiner Flucht aus dem Heim – sie galt der Suche nach dem wunderbaren Heimvater, der versetzt worden sei, in Wahrheit aber verstarb (wieder so eine nachträgliche Schicksalsinformation) – ist Peters kindliche sozialistische Persönlichkeit bereits so gefestigt, dass er von einer ziemlich bürgerlichen Familie des sozialistischen Adels, nämlich Nachfahren eines Widerstandskämpfers gegen die Nazis, adoptiert werden kann. Seine Heimat ist fortan eine bröckelnde Villa in Berlin-Treptow. Man kann an Uwe Tellkamps "Turm" denken. Peter, der schon als Heimkind gegen das Zertrampeln von Grünflächen gekämpft hatte - "warum zerstören wir mutwillig, was uns allen gehört?" - bleibt bei seiner unbedingten sozialistischen Gläubigkeit.
Wenn ein Mitschüler schlecht über den Staat redet, plappert Peter es entrüstet herum, worauf dieser von der Schule fliegt. Einer subversiven Punk-Band dient er als als Sänger, der Parteilieder wie „Sag mir, wo du stehst“ zu harten Elektroklängen so inbrünstig kräht, dass nur er die Ironie nicht versteht. Westbesuche will er mit dem Neuen Deutschland bekehren. Auch mit der Stasi spricht er - warum nicht mit Experten reden? -, allerdings erzählt er auch das herum, sodass die Konspiration misslingt.
Was ist das für ein Schelm? Einmal wird er „ein Kaspar Hauser“ genannt. Dass die Leute den kleinen Streber zu fürchten beginnen, entgeht ihm. Peter Holtz nimmt seine sozialistische Umgebung zum ideologischen Nennwert, als gäbe es keine Kluft zwischen den Worten und der Wirklichkeit. Macht, Gewalt, Zynismus – dafür ist er taub oder farbenblind. Ingo Schulze konstruiert einen Homunkulus des Sozialismus, von dem nicht immer klar ist, ob man ihn komisch oder grauenhaft finden soll.
Daher geht ihm die Filouhaftigkeit klassischer Schelmen von Lazarillo bis zum Soldaten Schweijk ab. Seine Affirmation ist total, sie hat auch nichts von Sklavensprache. Subversiv ist Peter Holtz durch die vollkommene Abwesenheit von Subversivität. Der Name scheint sprechend, er ist ein Holzkopf. Wie bringt man eine solche gläubig kommunistische Figur in den Kapitalismus? Das ist, nach einem etwas behäbig vor sich hintuckerndem Beginn, die interessante Aufgabe, die Ingo Schulze sich vorgenommen hat. Er löst sie mit sanftem Witz. Mit dem Jahr 1989 nimmt der Schelmenroman Fahrt auf.
Zwei Voraussetzungen muss Schulze seinem Peter dafür noch andichten. Schon vor der Wende wird Peter Holtz Christ. In aller Unschuld findet er nämlich, der Kommunismus sei nur die andere Seite des Christentums: „Mit dem Glauben verfüge ich über ein zweites Standbein.“ So kann er in die Ost-CDU eintreten, und mit sich im Reinen bleiben. Die zweite Voraussetzung für Peters Nachwende-Karriere ist sein Immobilienvermögen. Häuser sind eine Last in der DDR, renovierungsbedürftig, kostspielig, ertragsarm. Also wird dem linientreuen Maurer (das lernt der schlichte Schelm) von seiner ostbürgerlichen Umgebung ein Haus nach dem anderen überschrieben. Irgendwann hat er „zwölf Mietshäuser, eine Villa und zwei Buden in Mitte“, und dafür muss er schuften: Er fährt schwarz Taxi, um Geld für Handwerker aufzutreiben.
Beides, die Ost-CDU-Vergangenheit und das Immobilienvermögen, erlaubt Peter Holtz, der den Mauerfall im Koma verschläft wie die Mutter in dem Film „Good bye, Lenin“, eine politisch-ökonomische Blitzkarriere in der Nachwende-DDR. Er kommt in Berührung mit Roman-Stellvertretern von Lothar de Maizière und Angela Merkel. Die Schrottimmobilien sind auf einmal großes Kapital. Peter Holtz ist kurz Wende-Held, und auf Dauer Millionär.
Hier wird der Roman lustig, er bekommt etwas vom Brio der Anfänge Ingo Schulzes, die ja immer wieder vom Augenblick des Glücks der ungeheuren Offenheit 1989/90 handelten. Peter Holtz lernt den Kapitalismus nicht nur kennen, irgendwann verinnerlicht er ihn. Er will gut sein zu seinen Mietern, aber auch zu einer Prostituierten, bei der er zu seiner grenzenlosen Überraschung erfahren hat, dass Sex für Geld funktioniert. Also richtet er ihr ein kleines kuschliges Bordell in der Auguststraße, dem späteren Galerie- und Kunstkiez in Mitte ein.
„Holtz-Immobilien“ ist kurz davor, zum Imperium zu werden: Shopping-Malls an Fabkrikstandorten, Wellness in einer Traglufthalle, Schnäppchen bei der Treuhand. Peter schlafwandelt weiter treuherzig durch die Welt, diesmal lässt er sich, bezeichnenderweise von einem Kunsthändler, in Marktwirtschaft belehren. Wer Eigentum verschenken wolle, erklärt ihm dieser, der überlasse die Geschicke dem Zufall, schaffe bestenfalls Lottogewinne für die Empfänger.
Volkseigentum werde verschlissen (der zertrampelte Rasen vorm Kinderheim!), nur Eigentum erlaube Verantwortung, und überhaupt: „Es ist noch kein besseres Mittel als Geld erfunden worden, um Gerechtigkeit herzustellen.“ Die Religion von Eigentum und Verantwortung übernimmt Peters hölzerner Kopf erst einmal. Sogar shoppen und ein wenig genießen lernt er, das tiefe Befremden über die Warenwelt mit ihren nachwachsenden Regalen im Supermarkt und dem Service-Sprech des Personals, hält eine Erfahrung von 1990 frisch. Aber freilich: Es bleibt Peter unangenehm, von Dienern bedient zu werden, auch wenn man ihm hundertmal erklärt, das sei Arbeitsteilung. Das sozialistische Ich ist nicht tot, es wird ja noch gebraucht.
Fassungslos erkennt Peter Holtz, der eine subversive Halbschwester hat, die eine Galerie führt, dass Kunst Geld schaffen kann. Peter wird zu einer Performance verleitet, bei der er in einer Galerie mehr als 800 000 DM in Scheinen verbrennt. Wird hier Geld vernichtet? Keineswegs! Der Film, der das Event dokumentiert, bringt schon in erster Lizenz mehr als eine Million DM ein. Peter Holtz, der etwas von einem Midas hat, dem alles zu Gold wird, und der zugleich weniger Schelm als Candide in der besten aller ökonomischen Welten ist, kann das Geld nicht loswerden.
Nicht, dass die Gesellschaft insgesamt besser würde. Anzeichen von Unordnung mehren sich: Das kleine Privat-Bordell zieht gewaltbereite Konkurrenz aus Osteuropa an. Abgewickelte Fabrikbelegschaften protestieren und suchen nach selbstbestimmten Managementalternativen. Nazis tauchen auf. Versuche, die Steuerverwaltung zu bereden, mehr zu zahlen, scheitern bürokratisch. Der Reichtum Peters zieht einen Erpresser an. Die Adoptivmutter wird Direktorin bei der Deutschen Bank und sackt das Filialnetz der Staatsbank der DDR ein. Anders als im Sozialismus übersieht Peter diesmal die Kollateralschäden nicht. Der Schelm wird auf dem rechten Auge sehend.
Eine Begegnung mit Gerhard Schröder - der „ist jemand, der zuhört, der nachfragt, den interessiert, was andere Menschen denken“, wird ihm versichert – gibt Peter den Rest. Übrigens tritt Schröder als einzige historische Figur mit Klarnamen auf, der Roman verlässt also an seinem Ende kurz den Bezirk der Fiktion. Nun sucht Peter verzweifelt die „Selbstreinigung des Kapitalismus“: „Wenn das Geld zum Henker der Dinge wird, hat es keine Berechtigung mehr.“ Am 1. September 1998, kurz vor Schröder Amtsantritt, ist es so weit: An der Weltzeituhr beginnt die diesmal nicht künstlerische, sondern unsymbolische Geldverbrennung, die zu Aufruhr und Einweisung ins Heim führt. Das Geld beweist seine dämonische Macht noch in der Vernichtung, welche die Menschen verrückt macht: „Se können doch nicht unser Jeld verbrenn!“ Allerdings: Geld kann man gar nicht verbrennen. Es steht ja in den Büchern.
Wie alle Kunstwerke vom Geld handelt Ingo Schulzes Roman von einem Fluch. Gibt es ein Jenseits? Ja, an einer Stelle. Peter Holtz reist einmal nach Südfrankreich. Die Schönheit der Sprache dort, das Licht, der Himmel, die Natur überwältigen ihn. „Ich sehe die Dinge und Wesen dieser Welt an, als würde ich zum ersten Mal ihrer Körperlichkeit gewahr. Plötzlich erschreckt mich die Idee: Es muss sich gar nichts ändern! Alles soll bleiben, wie es ist!“
Das wäre die Welt, in der es keine Kluft zwischen den Worten und den Verhältnissen gibt. Ist es wieder einmal das südliche Licht, das vom Hadern mit den Abstraktionen erlöst?
Peter Holtz hat etwas
von einem Midas,
dem alles zu Gold wird
Ingo Schulze
Foto: Regina Schmeken
Links:
Berlin Mitte,
Juli 1992.
Hier wird Peter Holtz
zum Millionär, indem er einstürzende
Altbauten renoviert.
Foto: Gade-Ullstein
Rechts:
Brüssel, Zentrum,
Mai 2017.
In Robert Menasses
Roman wird in der
Hauptstadt Europas
ein Mord vertuscht.
Foto: imago/ZUMA Press
Ingo Schulze:
Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2017. 570 Seiten, 22 Euro. E-Book 19,99 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de